zweifache Katastrophe: von der frühpubertierenden Geliebten wird er verraten, in eine Falle gelockt; ohne Hose steht er vor ihr und den Gleichaltrigen da. Und bei seinem ersten Großeinsatz als Polizist wird Max verwundet: Schüsse ins Bein, auch die kommen von den eigenen Leuten. Sie treffen ihn auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck, in der Nacht des 5. September 1972, bei dem gescheiterten Versuch, die von der PLO-Gruppe "Schwarzer September" zuvor im Olympiadorf genommenen israelischen Geiseln zu befreien. Die Nachtausgaben der Zeitungen brachten damals zuerst die Wunschmeldung: alle Geiseln seien befreit, alle Terroristen tot.
Als sich das Dunkel verzieht, wird dann die wahre Bilanz des größten Desasters der deutschen Polizei sichtbar: alle Geiseln tot, fünf Terroristen tot, drei gefangen. Das ist die Nachricht. Daneben bleibt unbeachtet, wie ein "auszubildender Polizist mitten im Kugelhagel zwischen Scharfschützen und Geiselnehmern über das Flugfeld rannte, hin und her wie ein aufgescheuchter Hase, eine vom Licht der brennenden Hubschrauber grell beleuchtete Gestalt".
Max überlebt beide Verletzungen, ein Hinkefuß bleibt. Er verläßt den Polizeidienst, studiert Biologie, gründet eine Familie und wird "Elefantenkoordinator" in Rotterdam. Was das für eine Funktion ist, bleibt ein wenig rätselhaft. Max' Funktion in Ulrike Draesners drittem, bisher umfangreichstem Roman dagegen ist deutlich. Am Fall des unglücklichen Jugendfreunds kann nämlich Katja, inzwischen eine erfolgreiche Fotoreporterin, die Gültigkeit eines "Familienmantras" erforschen.
Jozef, ihr aus Schlesien heimatvertriebener Großvater und Sammler von Zuckerstückchen, hat es formuliert: "Die große und die kleine Geschichte kümmern sich nicht umeinander, sie durchdringen sich bloß." Am Ende ihrer Recherche weiß Katja es genauer: "Jedes Durchdringen schließt Berührung ein, bedeutet Veränderung ... Das ,Unglück' im September 1972 war kein Unglück, ... sondern eine unwahrscheinliche Mischung aus exakter Planung, grober Nachlässigkeit, heiterer Sorglosigkeit; ein riesiges Puzzle mit einem Loch in der Mitte." Indem Katja die Ereignisse vom Sommer '72 rekonstruiert, kann sie schließlich ihre Schuld an Max' Unglück bestimmen: Wenn sie ihn nicht verraten hätte, wäre er nicht zur Polizei gegangen und nicht in das Schußfeld der "großen" Geschichte geraten. Dreißig Jahre danach kann sie sich entschuldigen, sie weiß jetzt, wofür. Ein knappes Telefonat; das Ergebnis ist typisch für die Ambivalenzen, die hier herrschen. Halb nimmt er die Entschuldigung an, halb läßt er sie abblitzen.
Mit erzählerischem Dispositionsgeschick entfaltet Ulrike Draesner die komplexen Verknotungs- und Durchdringungsverhältnisse von Privatgeschichte und Historie. Der 5. September 1972 war der Tag, an dem die "heiteren" Spiele von München zum Albtraum wurden. Die Fernsehbilder der vermummten Terroristen ("ob der Mann in der Maske wohl schwitzte? Es war warm.") überblenden sich für Katja mit dem skeptischen Blick auf die neue Freundin des Vaters, der quälenden Ungewißheit über den Unfalltod der Mutter. Als die Geiselnehmer in das Olympische Dorf eindrangen, war für sie "die Kindheit zu Ende. Sie wußte, daß das eine Konstruktion war, die Konstruktion entsprach ihrem Bedürfnis nach einer klaren Grenze, und Katja kam zupaß, daß die Grenze ein Datum im kollektiven Gedächtnis trug, der 5. September 1972, der dunkle Tag."
Aber: "The games must go on", hatte IOC-Präsident Avery Brundage damals gesagt. Sie gingen weiter bis zur Abschlußfeier. Da näherte sich dem vollbesetzten Olympiastadion, von Augsburg kommend, ein nicht identifizierbares Flugobjekt. Stadionsprecher Joachim Fuchsberger und August Everding, der Regisseur der Feier, entschieden, nichts zu sagen, um eine Panik zu verhindern. Es handelte sich um eine verirrte finnische Privatmaschine. Dies geschah am 11. September.
Auf die zahlenmystischen Operationen, die Draesner hier bemüht, könnte man gut verzichten und wird kaum bezweifeln: Mit "München" ("Munich" in Steven Spielbergs kommender Filmfassung des Stoffs) begann die Geschichte des globalen Terrorismus, es war das Ende der Heiterkeit nicht nur dieser Olympischen Spiele. Wer Zusammenhänge sucht, findet sie. So gelangt auch irgendwann Katja bei einem Informanten in Hongkong in den Besitz einer erstklassigen (und schon in Alan Dershowitz' "Why terrorism works" nachzulesenden) Verschwörungstheorie, nach der die Entführung einer Lufthansa-Maschine im Oktober des Jahres, bei der die festgenommenen PLO-Kämpfer freigepreßt wurden, in Absprache zwischen der israelischen und der deutschen Seite inszeniert war, um die heiklen Gefangenen loszuwerden und sie für die Mordkommandos des israelischen Geheimdienstes erreichbar zu machen. Sogar die PLO soll das Spiel mitgespielt haben.
So hilft am Ende der vielleicht etwas zu langen, etwas zu ambitionierten Romankonstruktion der Politthriller dem trotz gutem Sex mit einem Bibliothekar namens "Soysal" und trotz manch schöner Siebziger-Jahre-Details ermattenden Erzählfluß wieder auf. Bisweilen ist der ehrgeizige geschichts- und existenzphilosophische Diskurs etwas angestrengt mit Alltag und Lebenswirklichkeit perforiert. Derlei geht bekanntermaßen auch bei Thomas Mann nicht immer gut. Draesners "Spiele" ist eine imponierend souverän gelegte Roman-Patience. Nur daß sie allzu glatt aufgeht. Ganz am Schluß läßt Katja ihren bis dahin stets streng geschlossenen BH fallen, und das auf offener Straße. Ein schöner Moment der Befreiung, ein bißchen spät.
HOLGER NOLTZE
Ulrike Draesner: "Spiele". Roman. Luchterhand Literaturverlag. München 2005. 494 S., geb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
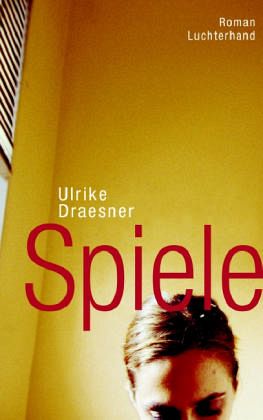





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.09.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.09.2005