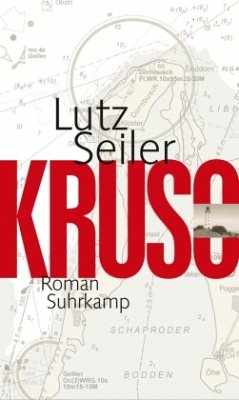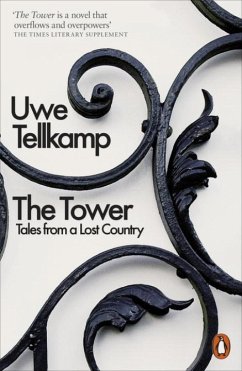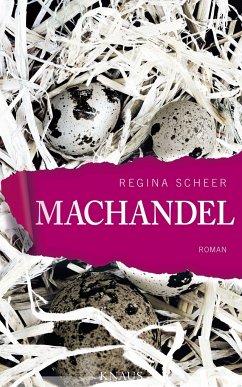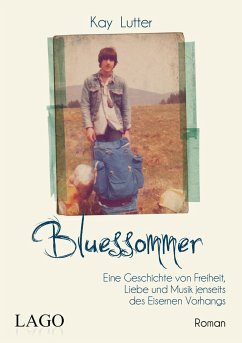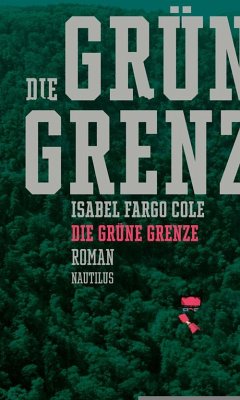ins Karl-May-Museum, sondern durch Cottbus. Nach dem Studium aber wird er zum Experten des Nahverkehrs in der DDR, jenem Land, das für Fernreisen lediglich streng kontrollierte Routen in die östlichen Bruderländer vorgesehen hat.
Dieser namenlose Ingenieur ist der Ich-Erzähler von Joochen Laabs' Roman über einen späten Reisenden, dem der Autor unverkennbar autobiographische Züge verliehen hat. Laabs, 1937 ebenfalls in Dresden geboren, arbeitete Mitte der fünfziger Jahre zunächst selbst als Straßenbahnfahrer. Später war er dort Mitarbeiter eines Forschungsinstituts für den städtischen Verkehr. Als Laabs dann mit dem Schreiben begann, bewegte er sich zunächst auf vertrauten Gleisen. Der erste Gedichtband, 1969 erschienen, verband bereits in seinem Titel kulturelle Gegensätze im Zeichen des Nahverkehrs: "Eine Straßenbahn für Nofretete". Es folgten weitere Gedichte, dazu Erzählungen und Romane aus dem sozialistischen Alltagsleben. Trotzdem wird Laabs selten genannt, wenn von der Literatur aus der DDR die Rede ist; zu unspektakulär, wohl auch zu unpolitisch erschienen seine Bücher für westliche Leser und für sein eigenes Land erst recht. Seine Erfahrungen in den Vereinigten Staaten - 1986 und 1991 hatte er dort Gastdozenturen inne - inspirierten ihn jetzt offenbar zu der Handlung seines neuen Romans.
Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der DDR also gelangt der Protagonist aus Dresden endlich in den Westen, wo er als Gast eines kleinen Colleges, irgendwo zwischen den Maisfeldern Iowas, als seltsamer Exot von Party zu Party herumgeschickt wird. Hier und an anderen Orten - New Orleans, Denver, Chicago, San Diego - hält der zum politischen Experten ernannte Ingenieur die immergleichen Vorträge, in denen er sich und seine Landsleute zur Freude seiner reichlich arglosen Zuhörer in einer etwas naiven Bildersprache mit Süßwasserfischen vergleicht, die unversehens ins aggressive Salzwasser versetzt wurden. Die DDR ein zerbrochenes Aquarium? Kein schlechter Vergleich, der das Lebensgefühl vieler Menschen unmittelbar nach der Wende widerspiegeln mag.
Kapitel für Kapitel werden amerikanische Gegenwart und ostdeutsche Vergangenheit einander gegenübergestellt, freilich in mitunter etwas ermüdender Gleichförmigkeit. Überzeugender als die Gesamtkomposition des Romans sind deshalb die Miniaturen, in denen Laabs das Alltagsleben in beiden Welten schildert. Hier gelingen ihm pointierte Schilderungen, oft voll Witz und stets mit großer Sympathie für seine Figuren, die allesamt keine großen Helden sind.
Der Bericht über die Beschaffung der ersehnten Schrankwand für die neue Wohnung in der sächsischen Plattenbausiedlung etwa wird zum grotesken Lehrstück über sozialistische Planwirtschaft; die Schilderung einer Dienstreise nach Prag ist ein tragikomischer Spiegel der politischen Hoffnungen des Frühlings 1968. In den Koordinaten der politischen Geschichte entfaltet Laabs das private Leben seines Protagonisten, das in seiner Vorhersehbarkeit typisch ist für den Mittelstand der DDR, also für den allergrößten Teil der Bevölkerung: Kindheit und Jugend mit den Entbehrungen der Nachkriegszeit, erste Liebe und Heirat, bescheidener Wohlstand im Neubau, Familienurlaub nach zugeteiltem Kontingent an der Ostsee, kleine Fluchten aus dem Alltag durch Flirts am Arbeitsplatz, leise Sympathien für Künstler, die die Grenzen des staatlich Erlaubten überschreiten - dieser Lebensentwurf wurde zwischen Harz und Oder unzählige Male variiert. Ungewöhnlich ist allerdings die Geschwindigkeit, mit der der Dresdener Verkehrsplaner nach der Wende in den Westen Amerikas katapultiert wird. Mit dem naiven Blick des Neuankömmlings staunt er über die seltsamen Gebräuche in einem Land, in dem Frühstücksmarmelade in Eimern serviert und rohes Gemüse als Party-Snack gereicht wird, was nun wiederum auch nicht gerade das Zentrum des "American way of life" trifft. Alle Gästezimmer, die er bewohnt, erscheinen ihm ebenso stereotyp eingerichtet wie die Plattenbauwohnungen in seiner Heimat, was der Reisende freilich gelassen hinnimmt, ahnt er doch längst, daß die Wildwest-Phantasien seiner Kindheit nicht der Realität entsprechen. Daß aber ein Zuhörer seiner Vorträge die DDR-Bewohner nun selbst mit Indianern vergleicht - vom Aussterben bedroht und ohne wirtschaftlichen Nutzen für die Gesellschaft -, offenbart die politische Unbedarftheit der akademischen Gastgeber, denen der Ingenieur aus der DDR als Bewohner einer phantastisch fremden Welt erscheint.
Seltsame Begegnungen ereignen sich. In der amerikanischen Provinz trifft der sächsische Ingenieur einen begeisterten Chamisso-Forscher, der diesen frühen Weltreisenden, dessen adelige Familie vor der Französischen Revolution in die preußische Monarchie geflohen war, als Heros der deutschen Literatur verehrt. Von Chamisso hat der deutsche Gast aber noch nie etwas gehört und versucht nun unbeholfen, seine Unkenntnis zu vertuschen. Die Botschaft ist deutlich: Joochen Laabs hat sein Alter ego nicht als neuen Chamisso erfunden, den die Begegnung mit der fremden Kultur zum Schriftsteller und Intellektuellen macht, sondern er läßt seinen Romanhelden bis zum Ende als staunenden und etwas ungeschickten Besucher durch die Neue Welt ziehen.
Am Schluß des Romans steht wieder ein Traum, malt sich der Erzähler doch ein Wiedersehen mit Frau und Tochter in der imposanten Landschaft der Rocky Mountains aus. Das aber ist leider unmöglich, denn die beiden erleben zu Hause gerade die Turbulenzen der deutschen Vereinigung. Davon berichtet Laabs aber nur aus der Ferne, und es bleibt offen, ob sein Held sich zur Rückkehr zu den deutschen Straßenbahnschienen und in den Schoß der Familie entschließen wird. Dadurch freilich erhält der Roman auch eine leise Note des Zweifels und einer existentiellen Unsicherheit, was zu seinem stillen Reiz beiträgt.
SABINE DOERING
Joochen Laabs: "Späte Reise". Roman. Steidl Verlag, Göttingen 2006. 604 S., geb., 22,- .
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
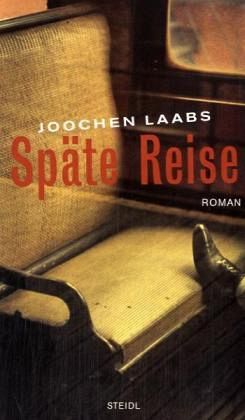




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.09.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.09.2006