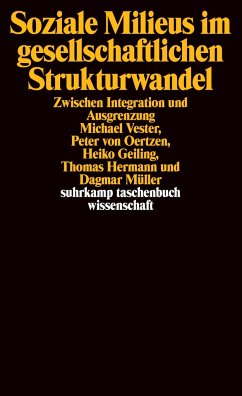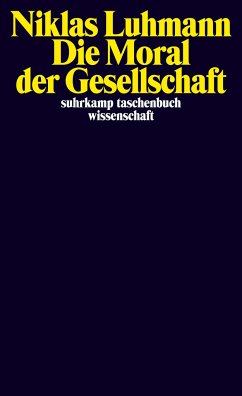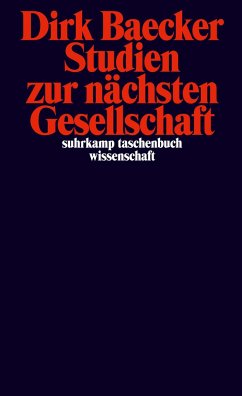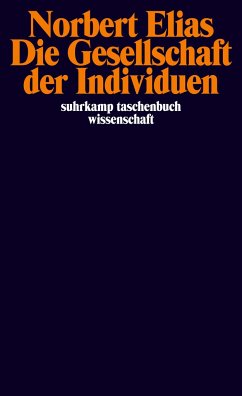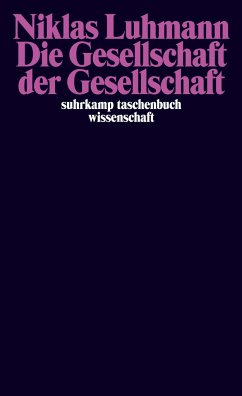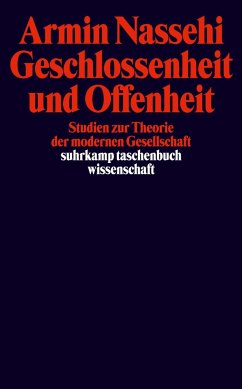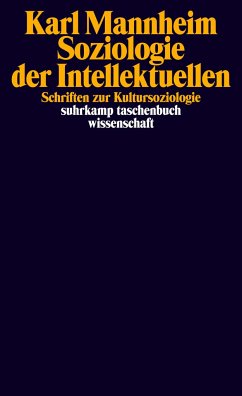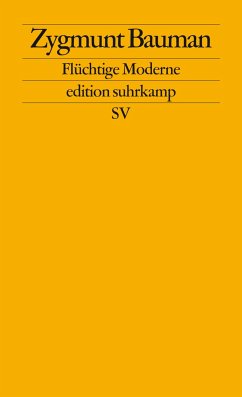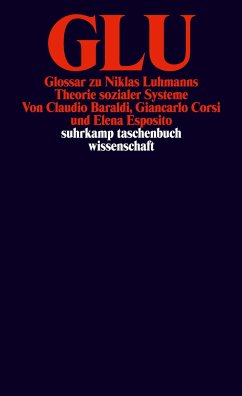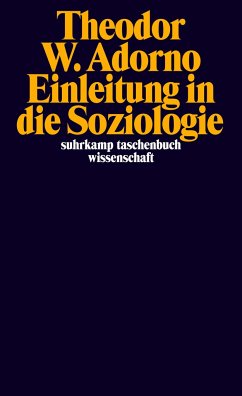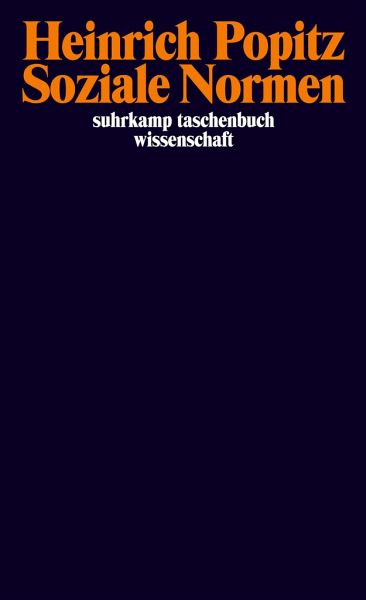
Soziale Normen
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der 2002 verstorbene Freiburger Soziologe Heinrich Popitz gehört zu den bedeutendsten Nachkriegssoziologen in Deutschland. Bereits Klassikerrang haben seine industriesoziologischen Arbeiten aus den fünfziger Jahren, aber auch die Bedeutung der in den folgenden Jahrzehnten entwickelten Schriften zur Macht-, Norm-,Technik- und Kreativitätstheorie ist in jüngster Zeit zunehmend gewürdigt worden. Popitz war ein »Meister der kleinen Form«, der seine Überlegungen in subtilen wissenschaftlichen Essays entwickelte. +++Der Band versammelt neben noch unveröffentlichten Texten Popitz' wichtigste...
Der 2002 verstorbene Freiburger Soziologe Heinrich Popitz gehört zu den bedeutendsten Nachkriegssoziologen in Deutschland. Bereits Klassikerrang haben seine industriesoziologischen Arbeiten aus den fünfziger Jahren, aber auch die Bedeutung der in den folgenden Jahrzehnten entwickelten Schriften zur Macht-, Norm-,Technik- und Kreativitätstheorie ist in jüngster Zeit zunehmend gewürdigt worden. Popitz war ein »Meister der kleinen Form«, der seine Überlegungen in subtilen wissenschaftlichen Essays entwickelte. +++
Der Band versammelt neben noch unveröffentlichten Texten Popitz' wichtigste Schriften zur Normtheorie, die bisher nur verstreut vorlagen. Eine ausführliche Einleitung führt in Popitz' Denken ein.
Der Band versammelt neben noch unveröffentlichten Texten Popitz' wichtigste Schriften zur Normtheorie, die bisher nur verstreut vorlagen. Eine ausführliche Einleitung führt in Popitz' Denken ein.