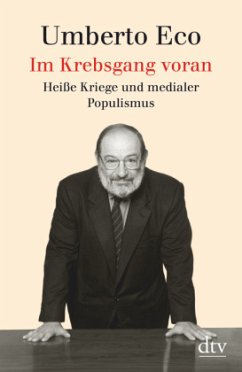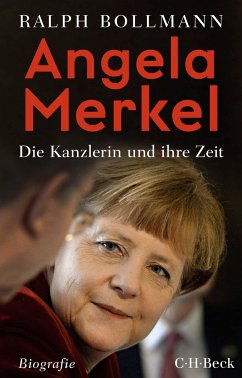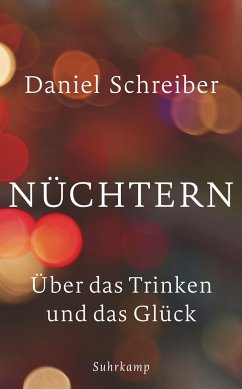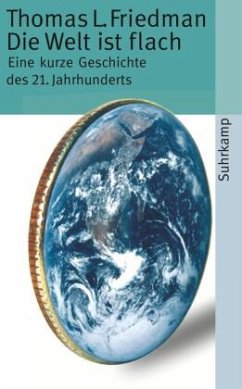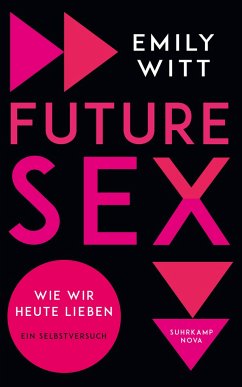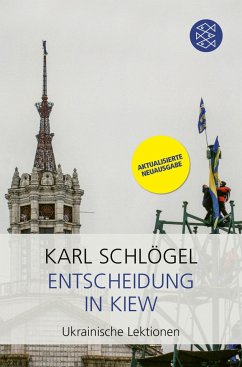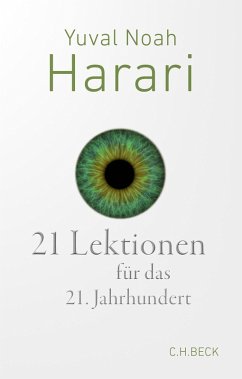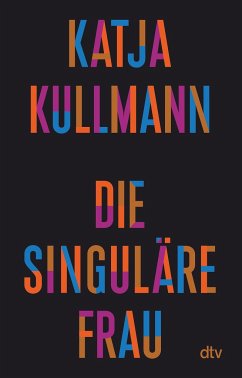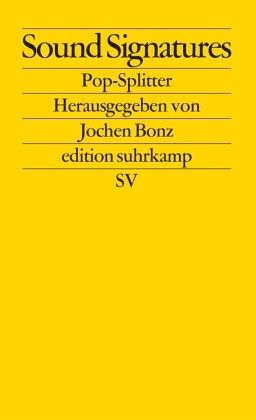
Sound Signatures
Pop-Splitter
Herausgegeben: Bonz, Jochen;Mitarbeit: Bonz, Jochen; Poschardt, Ulf; Blümmer, Heike; Binas, Susanne; Uslar, Moritz von; Hammelehle, Sebastian; Krämer, Thorsten; Holert, Tom; Magdanz, Fee; Meinecke, Thomas;
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
19,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Was ist Pop? So wenig originell diese Frage ist, so originell, vielfältig und überraschend können die Antworten ausfallen, wenn man sie den Richtigen stellt: Schriftstellern wie Thomas Meinecke, Andreas Neumeister oder Thorsten Krämer; Musikern und DJs wie Dirk von Lowtzow (Tocotronic) oder Hans Nieswandt; Journalisten wie Diedrich Diederichsen, Ulf Poschardt, Pinky Rose, Sacha Kösch oder Moritz von Uslar; Wissenschaftlern wie Gabriele Klein oder Eckhard Schumacher.Alle Autorinnen und Autoren gehen in den vorliegenden Originalbeiträgen anhand der Beschreibung eines Gegenstands, einer Per...
Was ist Pop? So wenig originell diese Frage ist, so originell, vielfältig und überraschend können die Antworten ausfallen, wenn man sie den Richtigen stellt: Schriftstellern wie Thomas Meinecke, Andreas Neumeister oder Thorsten Krämer; Musikern und DJs wie Dirk von Lowtzow (Tocotronic) oder Hans Nieswandt; Journalisten wie Diedrich Diederichsen, Ulf Poschardt, Pinky Rose, Sacha Kösch oder Moritz von Uslar; Wissenschaftlern wie Gabriele Klein oder Eckhard Schumacher.
Alle Autorinnen und Autoren gehen in den vorliegenden Originalbeiträgen anhand der Beschreibung eines Gegenstands, einer Person, einer Moderichtung, eines (Schreib-)Stils der Frage nach, was Popkultur eigentlich ist. Diese Phänomenologie der derzeitigen Popkultur bildet insofern auf ebenso unterhaltsame wie erhellende Weise ab, wie in der Gegenwart Kultur wahrgenommen wird und als symbolische Ordnung funktioniert; und nicht zuletzt wird der Begriff selber einer Revision unterzogen, indem er - ganz nebenbei - in unendlich viele Teilchen zersprengt wird.
Alle Autorinnen und Autoren gehen in den vorliegenden Originalbeiträgen anhand der Beschreibung eines Gegenstands, einer Person, einer Moderichtung, eines (Schreib-)Stils der Frage nach, was Popkultur eigentlich ist. Diese Phänomenologie der derzeitigen Popkultur bildet insofern auf ebenso unterhaltsame wie erhellende Weise ab, wie in der Gegenwart Kultur wahrgenommen wird und als symbolische Ordnung funktioniert; und nicht zuletzt wird der Begriff selber einer Revision unterzogen, indem er - ganz nebenbei - in unendlich viele Teilchen zersprengt wird.