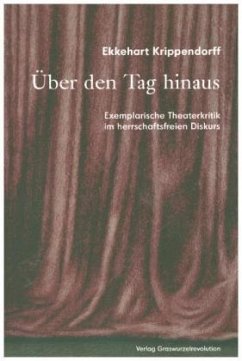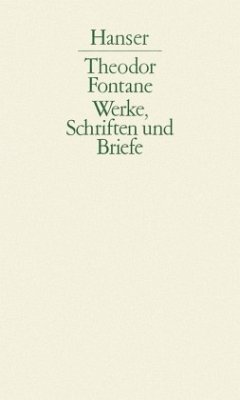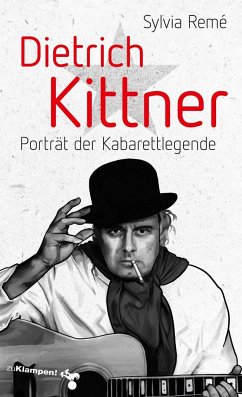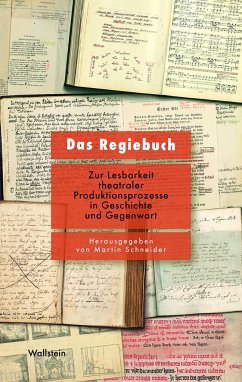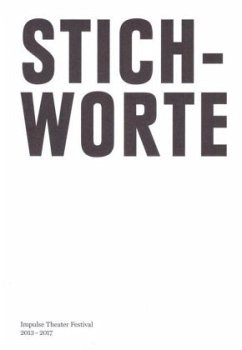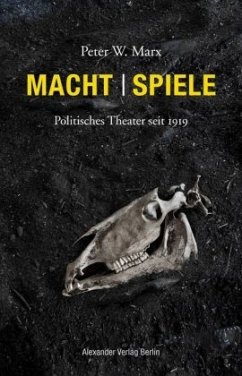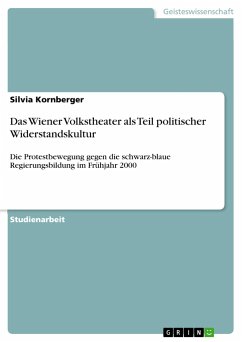Nicht lieferbar
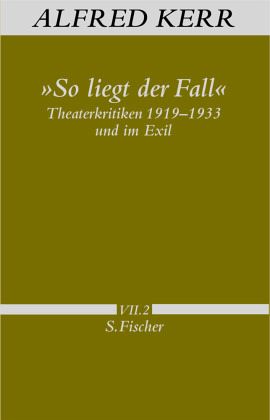
'So liegt der Fall'
Theaterkritiken 1919-1933 und im Exil
Herausgegeben von Rühle, Günther
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war Alfred Kerr der prominenteste und eigenwilligste Theaterkritiker deutscher Sprache. Unverwechselbar (und nicht selten imitiert oder parodiert) Anlage, Stil und Ton seiner Prosa. Dem empfangenen Eindruck entspricht prägnanter Ausdruck, bald subtil, bald ruppig, unter römischen Ziffern reihen sich knappe Abschnitte, manchmal ist es ein Aphorismus oder nur ein einziges Wort. Die Subjektivität ist unverhohlen und stolz. Die Eitelkeit vereitelt nicht, sondern fördert formulierte Erkenntnis. Alfred Kerr verstand die Kritik als gleichberechtigtes Gegenst...
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war Alfred Kerr der prominenteste und eigenwilligste Theaterkritiker deutscher Sprache. Unverwechselbar (und nicht selten imitiert oder parodiert) Anlage, Stil und Ton seiner Prosa. Dem empfangenen Eindruck entspricht prägnanter Ausdruck, bald subtil, bald ruppig, unter römischen Ziffern reihen sich knappe Abschnitte, manchmal ist es ein Aphorismus oder nur ein einziges Wort. Die Subjektivität ist unverhohlen und stolz. Die Eitelkeit vereitelt nicht, sondern fördert formulierte Erkenntnis. Alfred Kerr verstand die Kritik als gleichberechtigtes Gegenstück zu ihrem Objekt und sich selber als schöpferischen Künstler.
Die neue Ausgabe der Werke von Alfred Kerr reserviert den Theaterkritiken zwei Bände. Der erste enthält Arbeiten von 1893 bis 1919. Kerrs Kritiken aus der Zeit der Weimarer Republik und den Jahren des Exils sammelt dieser zweite Band.
In den Zwanziger Jahren erreicht Alfred Kerr die Höhe seiner Kunst, den Höhepunkt seines Wirkens als kritischer Beobachter des Theaters. Unabhängig von den zeitgenössischen Literaturmoden - Expressionismus und Neue Sachlichkeit, Zeitstück und politisches Theater -, immer wieder auch den klassischen Dramenfundus urteilssicher musternd, ist er offen für alles, was den »Ewigkeitszug« trägt oder doch schöpferische Originalität verheißt. Die »Diktatur des Hausknechts« Hitler zwingt den deutschen Juden Kerr 1933 ins Exil.
Die neue Ausgabe der Werke von Alfred Kerr reserviert den Theaterkritiken zwei Bände. Der erste enthält Arbeiten von 1893 bis 1919. Kerrs Kritiken aus der Zeit der Weimarer Republik und den Jahren des Exils sammelt dieser zweite Band.
In den Zwanziger Jahren erreicht Alfred Kerr die Höhe seiner Kunst, den Höhepunkt seines Wirkens als kritischer Beobachter des Theaters. Unabhängig von den zeitgenössischen Literaturmoden - Expressionismus und Neue Sachlichkeit, Zeitstück und politisches Theater -, immer wieder auch den klassischen Dramenfundus urteilssicher musternd, ist er offen für alles, was den »Ewigkeitszug« trägt oder doch schöpferische Originalität verheißt. Die »Diktatur des Hausknechts« Hitler zwingt den deutschen Juden Kerr 1933 ins Exil.