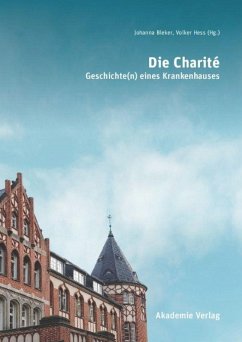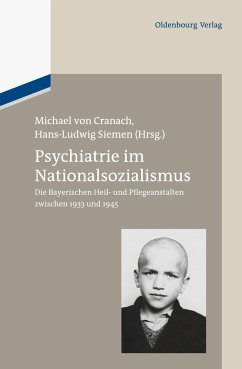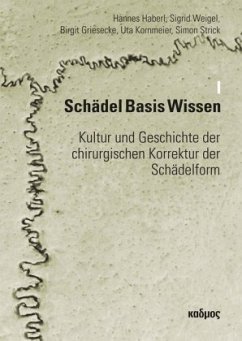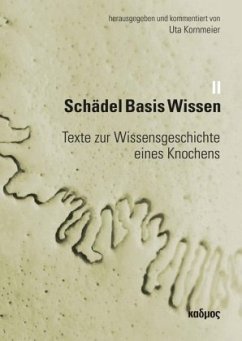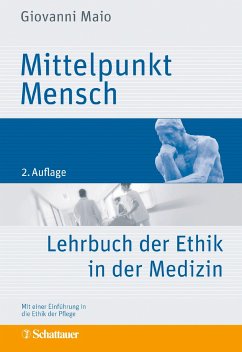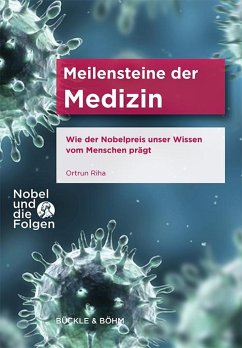Homöopathiebegründer Samuel Hahnemann korrespondierten. Da Hahnemanns neue Heilmethode damals bereits weithin bekannt war, schrieb man ihm Briefe und trug sein Leiden vor. Er wiederum behandelte Ratsuchende auf dieser schriftlichen Basis, führte also briefliche Anamnesegespräche, versandte Medikamente gegen Honorar und begleitete den teils langwierigen Verlauf einer Kur. Mehr als 5500 Patientenbriefe und Krankentageblätter aus den Jahren 1831 bis 1835 sind erhalten. 800 Briefe, geschrieben von etwa 50 Personen, wertet Brockmeyer nun aus.
Ihre Arbeitsfragen zielen weit über medizingeschichtliche Details hinaus: Wie spiegeln sich im Dialog mit dem Arzt die Körperwahrnehmungen der Zeit? Wie kommt die Religion, wie kommen das Geschlecht und geschlechtsspezifische Sorgen um sich selbst zum Tragen? Und schließlich: Wie stellen sich die um Gesundheit ringenden Ratsuchenden in Ichform dar? Wie konstituiert sich in den Briefen - wie Brockmeyer auf den Spuren Foucaults formuliert - ein "Selbst"?
Tatsächlich reizt das Material zu solchen Fragen. Denn die Spielregeln von Hahnemanns Homöopathie verlangen den Kranken eine ungewöhnliche Anstrengung ab: Möglichst genau und unbefangen sollen sie ihren Körper, Körperempfindungen und überhaupt Gemütsregungen schildern, damit der Arzt ihren Zustand präzise beurteilen und das richtige Medikament wählen kann. In der Intimität der Patientenbriefe kommen in gefühlter Authentizität Dinge zur Sprache, über die man sonst schweigt: schuppige Hautstellen, Schleim und Ausflüsse aller Art, Gerüche, Beschaffenheit des Stuhls.
Was den speziellen Ansatz der Homöopathie angeht, zeigt Brockmeyer vor allem, wie Hahnemann nicht nur willfährige, sondern auch skeptische und angesichts der Vielzahl medizinischer Schulen ungeduldige Patienten vor sich hat. Das Einvernehmen zwischen Arzt und Ratsuchendem ist fragil. Behandlungsabbrüche von beiden Seiten sind nicht selten. Auch der Laie hat eine Meinung.
Als besonders sanft gilt nicht nur das - zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits altmodische - Simile-Prinzip der Kur von Gleichem mit Gleichem, das der Homöopathie zugrunde liegt, sondern auch dass Hahnemann so stark auf Sprache setzt. Brockmeyer zeigt, wie die Selbstbeschreibung ein eigenes, vielgestaltiges Genre hervorbringt, das jenseits von Autobiographie, Beichte oder Geständnis liegt. Die homöopathische Selbstbeobachtung kann die Ratsuchenden bis zur Lust an der Selbstdarstellung heranführen, treibt aber auch die Selbstüberwachung voran. Dazu die Überwachung anderer: Besorgte Ehemänner schreiben für und über ihre Frauen, besorgte Mütter oder Väter über ihre Söhne und Töchter. Brockmeyer spricht von einem "präzisen Aufschreibesystem", das Hahnemann entwarf. Sie sieht es als Stärkung des schreibenden Selbst, die homöopathische Diätetik als Angebot einer "erreichbaren Meisterschaft", weniger als Disziplinierung.
Ansonsten mischen Hahnemanns Patienten munter, was die Wissenschaftsgeschichte zu trennen versucht: religiöse Versatzstücke und naturalistische Schilderungen, angelesene Homöopathie und traditionelle Säftelehre. Heterogene Gewissheiten stehen nebeneinander, ohne dass dies als Widerspruch erscheint.
Keineswegs durchgehend bedeutsam erscheint auch die Rolle des Geschlechts. Brockmeyer sieht eine entscheidende Trennlinie in der Ehe, mit der sich für beide Geschlechter die Bedeutung ihrer Körperzeichen ändert. Unverheiratete Männer sprechen als Subjekte von Sexualmoral. Sie berichten exzessiv von ihrem Geschlechtstrieb, Angst und Selbstkontrollbemühungen kreisen um Onanie und Pollution. Ledige Frauen thematisieren weder einen solchen Trieb noch das Thema Masturbation. Verheiratete hingegen verlagern ihre Aufmerksamkeit ganz auf eheliche Pflichten und Kinderzeugung. Im Zusammenhang des Beischlafs der Ehegatten gleicht sich die Bedeutung der Geschlechtsorgane und des Triebes an.
Wer sich für die Frage der Konstitution eines "Selbst" interessiert, muss sich mit den genannten Punkten begnügen. Ein knappes Kapitel zu Sterbeschilderungen reißt das Problem allenfalls an, womit das Buch, das differenziert begonnen hat, seltsam abrupt dann doch im Ungefähren endet. Was Ziel der Exploration sein sollte, bleibt am Ende begrifflich leer. Brockmeyers vorsichtig geäußerte Thesen beschränken sich auf Distanznahme. Sie wollen allzu grelle Einschätzungen aus der diskursorientierten Medizin- und Geschlechtergeschichte relativieren. Ein eigener Ansatz in Sachen Selbst ergibt sich aus ihnen nicht.
"Subjektivitäten" entstünden in der Beziehung zu anderen, so lautet ein Hinweis, um 1800 forme sich also keineswegs "das" autonome Subjekt. An einer anderen Stelle ist zu lesen, "Subjektivität" sei im Untersuchungszeitraum in einem Konglomerat aus Materiellem und Immateriellem anzusiedeln. Begriffe wie Konstruktion, Diskurs oder auch Erfahrung brächten Subjektivität aber nicht auf einen Nenner. Auch der Titelbegriff, der zum Nachdenken einlud - Selbstverständnisse -, bleibt am Ende unerläutert. Bei aller Materialfülle: Das enttäuscht dann doch.
PETRA GEHRING
Bettina Brockmeyer: "Selbstverständnisse". Dialoge über Körper und Gemüt im frühen 19. Jahrhundert. Wallstein Verlag, Göttingen 2009. 452 S., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
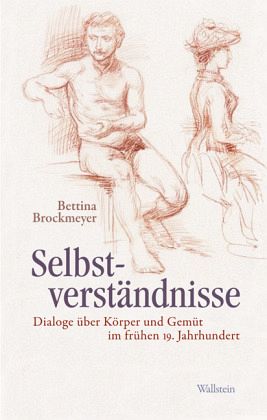




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2009