gewachsenes Phänomen. Die Zahl derer, die tatsächlich bereit waren, einen Großteil ihrer Zeit dort zu verbringen, stand von Beginn an in keinem Verhältnis zu den sieben Millionen offiziell angemeldeten Teilnehmern. Zwei Benutzergruppen von Second Life bildeten sich von Beginn an heraus: Auf der einen Seite die Freaks mit längerer Online-Erfahrung, die die dreidimensionale Erweiterung bisheriger Online-Gemeinschaften durch Second Life anzog. Auf der anderen die Kurzbesucher, die vom Reiz des Experiments angezogen wurden, ohne digitale Verhaltensmuster und Denkweisen zu entwickeln. Unterschieden blieben beide Gruppen vor allem darin, dass "professionelle" Benutzer auf einer strikten Trennung von Avatar- und Realidentität bestanden, die sporadischen Besucher dagegen in der neuen Wirklichkeit immer den Bezug zum Altbekannten suchten. Gemeinsam war beiden Besuchertypen der Wunsch nach regelloserem, unverbindlicherem Umgang und die Lust am Identitätsexperiment. Es lockte eine neue Wirtschaftsbranche mit Gewinnaussichten.
Es war klar, dass die Wissenschaft an Second Life nicht vorbeikommen würde. Die Erträge sind allerdings dürftig. Auch in den journalistisch gehaltenen Büchern von Christian Stöcker und Sven Stillich setzt die Eule der Minerva nicht zum Flug an. Stöcker zeigt sich noch aufgeputscht von der kurz zurückliegenden Reise ins virtuelle Metaversum und vermittelt eine anwendungsorientierte Übersicht. Gediegener und ausgeruhter, auch treffsicherer in der Wahl seiner Metaphern, liest sich der Überblick von Stillich, der die unvermeidliche soziologische und kommunikationstheoretische Durchdringung des Phänomens anbahnt. Durch die Schrumpfung der Kommunikation aufs Taktile und Auditive bringt Second Life - wen wird es wundern? - einen Verlust der primären Wirklichkeitserfahrung, näherhin des synästhetischen, atmosphärischen und sympathiebildenden Erlebens. Wo die Erfahrungen einschneidend werden, die Gespräche tiefsinnig, der Flirt verbindlich und die Atmosphäre dicht, hört die Kommunikation in Second Life meist auf. Andererseits führt der monosensuelle Dialog zu einer Schärfung des Bewusstseins für kognitive und linguistische Aspekte, die Stillich am Beispiel der virtuellen Prostitution herausarbeitet: Kommunikative Fähigkeiten wiegen bei der Online-Prostitution schwerer als körperliche Anziehungskraft.
Die Frage, ob sich in Second Life neue Formen der politischen Organisation entwickelt haben, lassen beide Bücher offen. Bisher fehlt der Plattform vor allem eine eigene Rechtsprechung, um als autonomer Sozialort gelten zu können. Stillich zufolge wird Second Life, auch wo es an seiner Rigidität und an technischen Mängeln scheitern mag, das Prinzip des Avatars, des digitalen Stellvertreters, hinterlassen, der sich künftig in verschiedenen Online-Welten bewegen und einen sukzessiven Identitätszuwachs erhalten wird.
Die Aussicht, dass der Tag weiterhin vierundzwanzig Stunden haben wird, ist für digitale Metaversen und ihre Bewohner nicht ohne Belang. Zwar kann die Virtualität erstaunliche biorhythmische Verschiebungen freisetzen, doch in ihrer Globalität liegt auch ihre Begrenzung. Wenn Gesprächspartner in unterschiedlichen Zeitzonen beheimatet sind, wird die körperliche Befindlichkeit empfindlich gestört, so dass der Versuch, an der weltumspannenden Vernetzung teilzuhaben, mit einer Fragmentierung des lokalen Soziallebens verbunden ist. Das ist im Augenblick alles, was der Wissenschaft zu Second Life einfällt.
THOMAS THIEL
Sven Stillich: "Second Life". Wie virtuelle Welten unser Leben verändern. Ullstein Verlag, Berlin 2007. 221 S., br., 7,95 [Euro].
Christian Stöcker: "Second Life". Eine Gebrauchsanweisung für die digitale Wunderwelt. Goldmann Verlag, München 2007. 205 S., br., 7,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
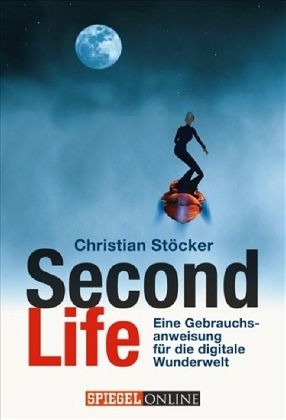




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.09.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.09.2007