literarische Bühne. Sein imponierendes Lebenswerk, insbesondere das Straflagerkompendium "Archipel GULag" und das dreibändige "Rote Rad" über die Vorgeschichte der Katastrophe von 1917, schuf er als drangsalierter Dissident und exilierter Eremit. Er arbeitete wie ein unermüdlicher Ährenleser, der hinter der Mähmaschine der patriotischen Sowjethistorie herzog, um all das zu sichern, was sie als Abfall weggeworfen hatte. Der Widerspruch zwischen staatlichem und menschlichem Blick auf die historische Erfahrung ist in Rußland besonders hart. Solschenizyns gesammelte menschliche Wahrheiten ergeben eine ganze Gegengeschichte.
Zwei jetzt auf deutsch herausgekommene späte Erzählungen, die des Autors prägende Jugenderlebnisse im Zweiten Weltkrieg verarbeiten, schließen den Kreis. Sie führen Solschenizyns Lebensthema von der selbstherrlichen staatlichen Obrigkeit, welche die besten Kräfte des Volkes verrät und verschleudert, zurück in den autobiographischen Mikrokosmos. Im Sommer 1943, da die Sowjetarmee die deutschen Besatzer allmählich aus Zentralrußland vertrieb, kämpfte der Schriftsteller als Kommandeur einer Schallmeßbatterie in der Gegend um Orjol. Liebevoll schildert die Geschichte "Sheljabuga Siedlung" den Arbeitseifer der einfachen Krieger, die technisch dürftig ausgestattet sind. Solschenizyns Helden wirken folklorehaft eindimensional und typisiert. Der umsichtige Zugführer Botnew, der unerschütterliche Sibirer Jermolajew, der naive Owsjannikow mit seinem Wladimirer Akzent verlegen unter deutschem Beschuß ihre Meßkabel, versuchen, sie instand zu halten, lokalisieren und identifizieren gegnerische Geschütze. Solschenizyn schildert das in einem Umgangston, der nicht selten künstlich klingt. Die Soldaten "pennen" wenig, es geht bei ihnen "hoch her", wenn die Deutschen "ballern", doch die unter Männern unvermeidlichen russischen Flüche werden höchstens erwähnt, nicht zitiert. Dafür formt diese Prosa Solschenizyns Aristokratie des Volkes, deren Angehörige man an ihrer bäuerlichen Festigkeit und schlichten Seele erkennt.
Als literarischer Memoirenschreiber will Solschenizyn sich zur Stimme dieses Volksbewußtseins machen. Der von der staatlichen Erinnerungstradition kultivierte ideologische Patriotismus hat bei ihm ebensowenig Platz wie die distanzierten Beobachtungen und Selbstbeobachtungen, wie man sie aus deutschen Kriegserinnerungen kennt. Das Kriegsgeschehen, das wie ein Unwetter über die Figuren hereinbricht, wird filmbildartig vergegenwärtigt, wie es dem Leser des "Roten Rades" vertraut ist. Das Bewußtsein zerbirst zu instinktiven Blitzlichtern wie "Brandgeruch!" oder "Laufen!" Diesem übermächtig pulsierenden Lebensstrom entzieht sich allein der politische Kommissar, der schmierige Politruk, der ausdrücklich erlaubt, eine Kirche zu beschießen, selbst nie mit anpackt, dafür aber den in einem Keller ausharrenden Dorfbewohnern verspricht, nach dem Krieg werde ein wunderbares Leben anbrechen. Solschenizyn hat den Ort der Befreiungskämpfe ein halbes Jahrhundert später besucht und schildert, was aus den Prophezeiungen wurde. Das Dorf war verwahrlost und verwaist bis auf drei entkräftete alte Frauen. In einer von ihnen muß der Autor jenes Mädchen erkennen, deren morgenfrische Schönheit für die Bunkerinsassen damals ihre Zukunftshoffnung zu symbolisieren schien.
Aber auch während des Gefechts ließ die politische Führung kämpfende Einheiten im Stich und schämte sich nicht, deren Verdienste sich selbst zuzuschreiben. Als exemplarisches Beispiel dafür wählt Solschenizyn seinen Kameraden von Sheljabuga, Major Pawel Bojew, der zu Beginn des Jahres 1945 als Kommandeur einer Artilleriebrigade in Ostpreußen von den Deutschen eingekreist wurde. Seine Stabsleitung hatte ihn ohne Deckung vorpreschen lassen und in der entscheidenden Phase obendrein die Telefonverbindung gekappt, um auszuspannen. Der unnötige Untergang des kampferprobten Bojew wiederholt die ebenso sinnlose Opferung der Armee von General Samsonow zu Beginn des Ersten Weltkriegs, den wie Bojew verantwortungslose Karrieristen in der Heeresleitung zu schnell zu tief in Feindesland vorschickten. In seiner nur vierundzwanzig Stunden umfassenden Erzählung "Schwenkitten" stellt Solschenizyn der auf ihren Endsieg zumarschierenden Sowjetführung ein ähnliches Zeugnis aus wie in "August vierzehn" dem zaristischen Oberkommando, das dem Untergang entgegenzog.
Hier liegt der Hauptgrund dafür, daß Solschenizyn eine unangefochten hohe moralische Autorität genießt, die wohl nie weit ausstrahlen kann. Es gehört zu den Paradoxien der russischen Geschichte und Gegenwart, daß die gleiche Bevölkerung, die über ihre selbstherrliche Obrigkeit klagt, nach dem Großmachtbewußtsein, das diese ihr zur Entschädigung einflößt, zu hungern scheint wie nach essentiellen Nährstoffen oder Rauschgift. Die Sündenregister russischer Befehlshaber gegen ihre Untertanen, die Solschenizyn zusammengetragen hat, erdrücken den Leser. Die höheren Etagen des russischen Staatsgebäudes müssen als Architektur der Niedertracht erscheinen. Immer wieder verlangt Solschenizyn von der russischen wie der westlichen Öffentlichkeit, sittlich zu handeln, sich selbst zu beschränken. Für die Eliten klingt das praxisfern. Der einfache Mann fühlt sich überfordert. Viele Russen, die wie der Autor bittere Fronterlebnisse persönlich oder von Zeitzeugen erfahren haben, lassen sich lieber von der patriotischen Propaganda trösten, als Solschenizyn zu lesen.
Alexander Solschenizyn: "Schwenkitten '45". Die autobiographischen Erzählungen. Aus dem Russischen übersetzt von Heddy Pross-Weerth. Verlag Langen-Müller, München 2004. 205 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
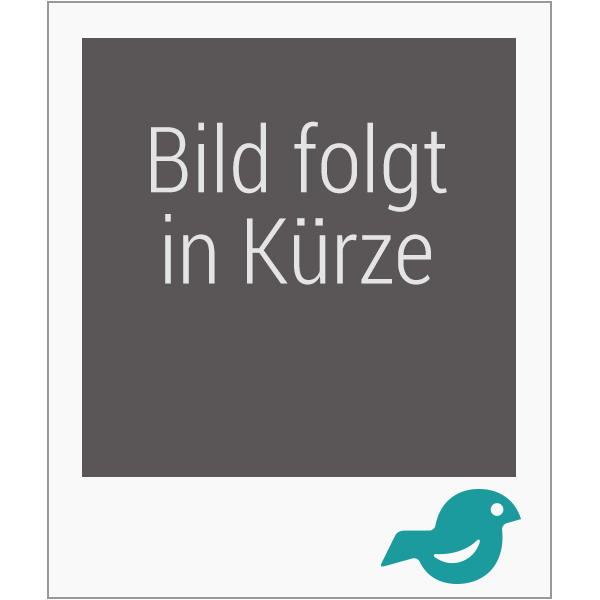





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2004