Schilderung der Ereignisse vom 2. Juli bis zum 5. August 1953 in Workuta, insbesondere in der 10. Lagerabteilung. Dort bauten Zwangsarbeiter in mehreren Schächten unter primitivsten Lebens- und Arbeitsbedingungen Steinkohle ab. Darunter befanden sich zahlreiche von Sowjetischen Militärtribunalen in der SBZ/DDR wegen politischer Delikte verurteilte deutsche Zivilpersonen, so auch Horst Hennig, der sich 1950 gegen das undemokratische Vorgehen bei den Studentenratswahlen an der Universität Halle gewandt hatte.
Der Streik in Workuta wäre ohne den Tod Stalins undenkbar gewesen, wenngleich dadurch noch keine Eruptionen verursacht wurden. Dass die Kunde vom Volksaufstand vom 17. Juni 1953 den Anstoß dazu gab, über einen Aufstand nachzudenken, wird zwar behauptet, aber nicht hinreichend belegt. Am wichtigsten war wohl die Nachricht über die Verhaftung von Innenminister Berija am 26. Juni, dem der GULag unterstanden hatte und der nun als "Feind der Sowjetunion" bezeichnet wurde. Daraufhin verlangten die Häftlinge eine Überprüfung ihrer Fälle. Nun bedurfte es nur noch eines Funkens, um das Pulverfass zur Detonation zu bringen. Ein Gefangenentransport aus dem Süden der Sowjetunion verweigerte angesichts nicht eingehaltener Zusagen und der ungewohnt harten Arbeitsbedingungen in Workuta Mitte Juli die Arbeit. Innerhalb kurzer Zeit kam es auch in anderen, benachbarten Schächten zu Arbeitsniederlegungen; am 22. Juli wurde in der 10. Lagerabteilung ein Streikkomitee gegründet, das Forderungen an eine aus Moskau erwartete Kommission formulierte. In deren Zentrum standen die Beseitigung von Willkür, Folter und Misshandlung sowie die Aufhebung der Urteile.
Im Verlauf der nächsten Tage breiteten sich die Streiks in dem gesamten Lagerkomplex weiter aus. Die Lageradministration versuchte zunächst, die Streikenden mit materiellen Vergünstigungen zu beschwichtigen und die Rädelsführer zu isolieren. Beides blieb erfolglos. Die Forderungen der Häftlinge radikalisierten sich zu der Formel: "Gebt uns Freiheit - geben wir Kohle!" Sie konnten darüber hinaus nicht nur verhaftete Aktivisten aus dem Lagerkarzer befreien, sondern veranlassten den Kommandanten der 10. Lagerabteilung am 26. Juli sogar dazu, das Lager zu räumen, wo jetzt das Streikkomitee das Kommando übernahm. Zwei Tage später traf die aus Moskau erwartete Kommission unter General Maslennikow, dem Chef der Lagerverwaltungen, ein. In seinem Auftritt vor den Streikenden wurde unübersehbar, dass er nicht auf die Kernforderung nach Freiheit und Gerechtigkeit eingehen wollte. Am 1. August machten bewaffnete Kräfte dem Aufstand ein Ende: 53 Tote und 123 zum Teil schwer Verletzte waren die schreckliche Bilanz dieses Tages. In den nächsten Tagen wurden noch weitere Streiks - auf allerdings weniger martialische Weise - beendet und die "Ordnung" wiederhergestellt.
Die spannende Darstellung lässt keinen Zweifel an der Spontaneität der Streiks, die nicht, wie von der Lagerverwaltung insinuiert, zentral geplant waren. Des Weiteren zeigt sie, dass Aufstände immer dann ausbrechen, wenn die Repression gelockert wird und die Macht der Herrschenden scheinbar erodiert. Nicht zuletzt deshalb wäre eine etwas ausführlichere Einbeziehung der anderen Erhebungen in den sowjetischen Lagern 1953/54 wünschenswert gewesen. Außerdem ist der Band sehr stark auf das Geschehen in Workuta konzentriert und versucht nicht, den Moskauer Entscheidungsprozess, der schließlich zur Entsendung von Maslennikow führte, etwas genauer auszuleuchten. Auch sollte man die Wirkungen des Aufstands nicht überschätzen: Er mag zur Umorganisation und Verkleinerung des GULag seit 1955/56 beigetragen haben, aber ob man ihn wie Karl-Wilhelm Fricke im Nachwort als "Anfang vom Ende des GULag-Systems" bezeichnen kann, erscheint zweifelhaft.
HERMANN WENTKER
Wladislaw Hedeler/Horst Hennig (Herausgeber): Schwarze Pyramiden, rote Sklaven. Der Streik in Workuta im Sommer 1953. Eine dokumentierte Chronik. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2007. 289 S., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
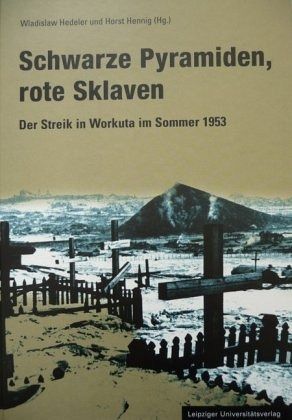




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.05.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.05.2008