Nobelpreis an, tanzt er also in einem Reigen mit Snorri und Halldór Laxness. Ein solcher findet dann gut auch mal in der weiten Welt da draußen Gehör. Für "Schattenfuchs" erhielt er 2005 den Literaturpreis des Nordischen Rates, nun ist er ins Deutsche übersetzt, und die Kritik hat ihn mit herzlicher Wärme aufgenommen, ohne dass man am Ende der Kritik so richtig verstanden hatte, womit er sich die Wärme verdient hatte.
Verstanden hatte man nur dieses: Der innovativste und aufregendste Autor Islands hatte einen Roman geschrieben, der sich mittels aufgebrochener Linearität um formale Modernität bemühte, während er inhaltlich gern tief in die Mottenkiste des isländischen Erbes sowie menschlichen Mitleids griff: mythische Elemente und wilde Natur, nostalgisches Setting im neunzehnten Jahrhundert, holzschnittartige Figuren; größtmöglicher Druck auf die Tränendrüse: im Kern der Geschichte finden wir ein bemitleidenswertes Geschöpf mit einem goldenen Herzen, nicht ganz unähnlich jener tölpeligen Selma, welche Björk in Lars von Triers "Dancer in the Dark" gab, jenem Film, dessen Songtexte eben auch Sjón schrieb.
Im Roman ist dieser Frauentypus noch ein paar Drehungen weiter hinuntergelassen worden in den Brunnenschacht des Unglücks: Diese Hafdís kommt mit dem Downsyndrom auf eine naturbelassene Welt, in der man eine wie sie für gewöhnlich direkt nach der Geburt ersticken würde. Sie aber überlebt - um dem Buch ein möglichst schweres Gravitationszentrum zu verschaffen. Erst wird sie vernachlässigt. Dann wird sie von ihrem Vater verkauft. Dann wird sie wie ein Tier in einem Schiffsbauch gehalten. Von der Mannschaft gewohnheitsmäßig vergewaltigt. Erleidet Schiffbruch. Und landet - natürlich - wieder an isländischen Gestaden. Um dort dann, in der Obhut einer guten Seele, zu Ende zu leben.
Wobei ihr Leben eigentlich überhaupt nicht interessiert. Fürs Buch muss sie nur, mit dem rasch wegerzählten schweren Schicksal beladen, sterben. Damit der Autor in die Vollen gehen kann. Ihrem Tod auf dem Fuße folgt nämlich das Erscheinen einer urzotteligen, "erdschwarzen" Füchsin - auf dem Umschlagbild hinreißend sinnfrei von einem gewöhnlichen Rotfuchs vertreten -, und die soll wohl als eine "Fylgja" zu verstehen sein, ein altnordischer Totengeist, der die Seele des verstorbenen Menschen in Tierform repräsentiert.
Die verbissene Jagd auf diese Füchsin ist es, der sich der Autor mit großer Hingabe widmet, und diese Jagd wird von keinem anderen betrieben als vom Pfarrer Baldur Skuggason, der uns am Ende des Buches als ebenjener Bösewicht eröffnet wird, welcher die arme Hafdís gezeugt und später dann an Seeleute verkauft hat. Über viele Seiten setzt er der Füchsin nach, und immerhin an Chuzpe mangelt es dem Autor nicht, denn hier streckt er eine Textmenge, die ungefähr derjenigen dieser Zeitungsseite entspricht, auf ein Viertel des Buches.
Wenn seine Sprache es hergeben würde, wäre das ja in Ordnung. Wenn sie so urwüchsig-erlebnishaft, so störrisch wäre wie die Landschaft, wenn seine Schilderungen das Erwartbare tief unter sich ließen, dann könnte das ja ein Labsal sein, dann würden der Mut des Autors und die Investition des Lesers in einen Roman von gerade mal 120 Seiten belohnt. Sjón aber, der Lyriker, spielt diese Einleitung sprachlich schlicht, und stellenweise geht seine Schmucklosigkeit - wenigstens in der vorliegenden Übersetzung - in ein trauriges Grau über. Wir lesen: "Die Landschaft lag makellos, so weit das Auge reichte", "Der Schneesturm peitschte aus allen Himmelsrichtungen", "Er konnte weder vor noch zurück und sah bald nicht einmal mehr die Hand vor den Augen".
Je öfter man sich an solchen Floskeln vorbeimüht, desto mehr fühlt man sich als Leser betrogen: So wie das schwerstmögliche Menschenschicksal heraufbeschworen wird, so wird auch denkbar naturnächste Erfahrung hergenommen, um auf billigstmögliche Weise den Leser ins Buch zu ziehen. Selbst wenn die sprachlichen Mittel dem gerecht würden, so bliebe immer noch die Frage klaffend im Raum: Was soll das? Gelänge die brachiale Naturromantik denn - wer brauchte sie? Was hätte sie in unserer Welt verloren? Welchen Weg ins Heute will der Autor uns weisen?
Viele warme Worte sind geschrieben worden über diesen Roman, der so ganz der reinen, zweckfreien, uneingebundenen Kunst verpflichtet zu sein scheint. In der Rezeption fällt eines ins Auge: dass dieses Buch alle seine Befürworter so seltsam nebulös werden lässt. Sie schwärmen von der Fuchsjagd, bemerken das irgendwie auch eingegliederte Schicksal der armen Hafdís, loben den unchronologischen Hüpfeschnitt als innovativ - nur, was das Buch uns zu geben hätte, verbleibt ein Rätsel, nein: verbleibt unklar.
Am stärksten ist Sjón, als er den jagenden Pfarrer in einer Schneelawine verschüttet. Visionen und Sensationen packen den hilflos Sterbenden, mit Erzählspaß dekliniert Sjón das durch - auf diese zwanzig Seiten scheint alles zugelaufen zu sein, auf die Begegnung zwischen Pfarrer und Füchsin, die ihm in seinen letzten Atemzügen erscheint. Das ist lebendig, manchmal hat es Witz und Pfiff. Dass aber um dieses ironische Sterben ein ganzes Buch drum herumgebastelt worden ist, dass man uns dieses dünne Brevier als Roman unterjubeln will und den Autor auch noch als aufregend - das ist dann doch ein bisschen zu viel Geflunker.
KLAUS UNGERER
Sjón: "Schattenfuchs". Roman. Aus dem
Isländischen übersetzt von Betty Wahl. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007. 126 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




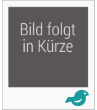

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.11.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.11.2007