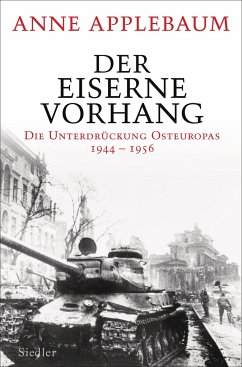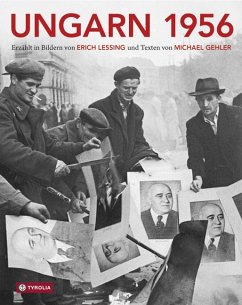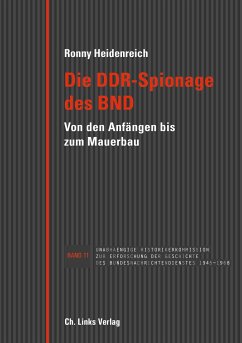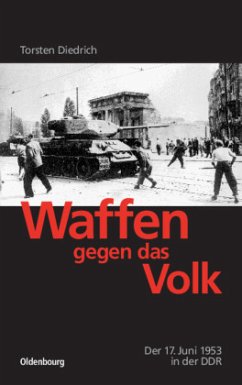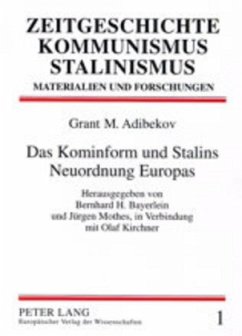Vergangenheit und Gegenwart: "So wie die Deutschen sich daran erinnern, daß mit dem politischen Umbruch in Ungarn 1989 und vor allem mit der Öffnung der ungarischen Grenze für die Flüchtlinge aus der DDR der Weg zur deutschen Einheit begann, so vergessen die Ungarn nicht, daß Deutschland ein verläßlicher Partner ihres Landes auf dem Weg in die westliche Werte- und Sicherheitsgemeinschaft ist."
Ein mahnendes Wort. Es würdigt zudem, daß die Studien aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt des Berliner FU-Forschungsverbunds SED-Staat und des Budapester Instituts für die Geschichte der Ungarischen Revolution 1956 hervorgegangen sind. Darin liegt ihr besonderer wissenschaftlicher Reiz. Im Mittelpunkt steht die sowjetische Politik gegenüber Deutschland und Ungarn nach Stalins Tod, die durch das Eingreifen der Moskauer Führung zur Bewältigung tiefreichender politischer Krisen als Folgen stalinistischer Parteidiktatur in beiden Ländern charakterisiert ist - eine fatale Gemeinsamkeit.
Als im Frühjahr 1953 an der Moskwa der Ernst der Situation begriffen und erkannt wurde, daß unverzüglich Reform vonnöten war, wurden Delegationen unter Leitung von Walter Ulbricht und Otto Grotewohl zum einen, Mátyás Rákosi und Imre Nagy zum anderen zu getrennten "Gesprächen" in den Kreml einbestellt. Hier wurde unmißverständlich oktroyiert, was hernach in Ost-Berlin und Budapest als Politik des Neuen Kurses umgesetzt werden sollte.
In Ost-Berlin und der DDR mißriet das Moskauer Krisenmanagement binnen weniger Tage. Die Beschlüsse von Partei und Regierung über den Neuen Kurs hatten das Umschlagen der Krise in den offenen revolutionären Konflikt nicht zu verhindern vermocht, im Gegenteil, einem Katalysator gleich beschleunigten sie den Aufstand vom 17. Juni. Sowjetische Panzer erstickten die Rebellion. Ulbricht konnte sich an der Spitze der SED behaupten. Der Sturz L. P. Berijas in Moskau ermöglichte es ihm sogar, seine von dem sowjetischen Geheimpolizeichef protegierten Widersacher Wilhelm Zaisser und Rudolf Herrnstadt kaltzustellen und ihnen ein Großteil seiner Verantwortung für die Krise zuzuweisen.
Im Lande der Madjaren schien der Neue Kurs vorerst erfolgversprechend. Rákosi, hauptverantwortlich für Massenterror und Wirtschaftsverfall, als Stalinist heillos diskreditiert, blieb bis 1956 Chef der ungarischen Staatspartei. Aber Imre Nagy - einst entmachtet - wurde 1953 als Ministerpräsident eingesetzt, bis sich sein Neuer Kurs an den alten Parteikadern brach. 1955 wurde er gestürzt. Man kennt das dramatische Geschehen in der Folgezeit. Als Nagy am 24. Oktober 1956 erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hatte der Aufstand des ungarischen Volkes schon begonnen. Am 25. Oktober floß das erste Blut in Budapest, zehn Tage später gingen Sowjettruppen in Ungarn zur bewaffneten Aggression über und schlugen den Aufstand blutig nieder.
Verschärfung des Klassenkampfes
Manfred Wilke und Tobias Voigt zeichnen die Entwicklung im Machtbereich der SED nach, ihre ungarischen Kollegen logischerweise die in ihrem Land, aber das Frappierende ihrer auf Fakten gestützten komparatistischen Betrachtungsweise ist die Vielfalt der Parallelen und Übereinstimmungen beim "Aufbau des Sozialismus" in der DDR wie in Ungarn. Der Einsatz früherer Moskau-Emigranten als Schlüsselfiguren in den jeweiligen Parteiführungen, die Instrumentalisierung des Staatsapparates, die Zernierung der nichtkommunistischen Parteien, die rigide Durchsetzung der Planwirtschaft bei unverhältnismäßiger Bevorzugung der Schwerindustrie, die Kollektivierung der Landwirtschaft ohne Rücksicht auf die Volksernährung, die Forcierung der Aufrüstung - im Prinzip stimmte das alles in der DDR und in Ungarn überein.
Übereinstimmung herrschte schließlich auch in der nach stalinistischer Manier eingeleiteten "Verschärfung des Klassenkampfes", im Einsatz von Justiz- und Geheimpolizeiterror als Mittel zur Herrschaftssicherung und zur Durchsetzung politischer Ziele, der unter Rákosi allerdings noch exzessiver, brutaler praktiziert wurde als unter Ulbricht. Die Folgen dieser Politik, ökonomische Stagnation und strukturelle Herrschaftskrisen - in der DDR zugespitzt durch eine "Abstimmung mit den Füßen" in Gestalt permanenter Massenflucht -, traten schier unausweichlich ein. Der 1953 in Moskau beschlossene Neue Kurs, der der Politbürokratie sowohl der SED wie ihrer "Bruderpartei", der Partei der Ungarischen Werktätigen, zwingend auferlegt wurde, resultierte wesentlich aus der Erkenntis, daß die herangereiften Probleme nicht mehr in alter stalinistischer Weise zu lösen waren. Andererseits sollte das Machtmonopol der Kommunisten unangetastet bleiben. Insoweit glich der Neue Kurs der Quadratur des Kreises aus dem Schattenreich politischer Illusionen.
Auch bei den Anstrengungen zur Krisenbewältigung und ihrem Scheitern zeigen sich Parallelen, vor allem die, daß auch Stalins Nachfolger die Entscheidungen nicht ihren Satrapen in Ost-Berlin und Budapest überließen. Natürlich traten auch Unterschiede hervor. In der DDR konnte nach dem Juni-Aufstand 1953 die Diktatur der SED wesentlich schneller stabilisiert werden als das Regime in Ungarn. Hier schien umgekehrt ein Neuer Kurs mit reformerischer Tendenz zeitweilig zu gelingen, bis der Aufstand des ungarischen Volkes 1956 alle Hoffnung zunichte machte. Er führte zum Zerfall der Partei der Ungarischen Werktätigen, zur Invasion der Sowjetarmee und zur blutigen Niederschlagung der Volksrevolution. Die von den Machthabern im Kreml eingesetzte Gegenregierung unter János Kádár brauchte ein Jahrzehnt, um der Diktatur zu relativer Stabilität zu verhelfen. Im Zuge der "restaurativen Vergeltung" wurden etwa 12 000 ungarische Freiheitskämpfer verurteilt. Weit über zweihundert Todesurteile wurden vollstreckt. Auch Imre Nagy starb 1958 am Galgen.
In einem resümierenden Schlußkapitel wird "der gescheiterte Gesellschaftsvertrag zwischen Partei und Volk im sowjetischen Imperium" an den historischen Beispielen DDR und Ungarn problematisiert. In dieser vergleichenden Analyse und Geschichtsbetrachtung liegt der eigentliche Erkenntniswert des Buches, wobei sich vor allem die Darlegungen zur ungarischen Revolution auf neue, bislang unausgeschöpfte Quellen aus russischen und ungarischen Archiven stützen konnen.
Das Buch ist gut gegliedert, in einer klaren, eingängigen Sprache verfaßt, nicht überfrachtet mit wissenschaftlichen Fachtermini, aber es hätte mehr editorische Sorgfalt verdient. "Nazionalsozialisten" - das muß nicht sein. Der wechselnde Gebrauch der Kürzel USAP (deutsch) und MSZM (ungarisch) für Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei stört. Auch eine Bibliographie wird vermißt.
KARL WILHELM FRICKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
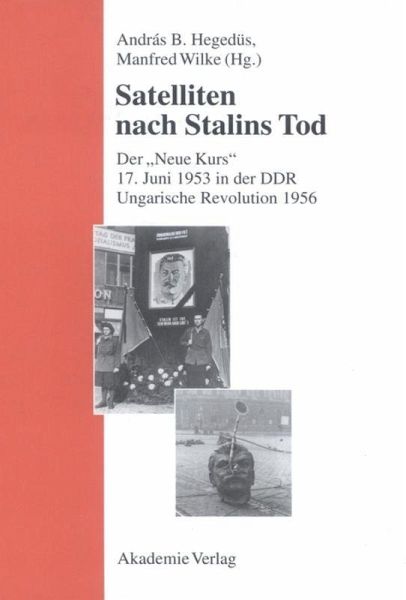






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2001