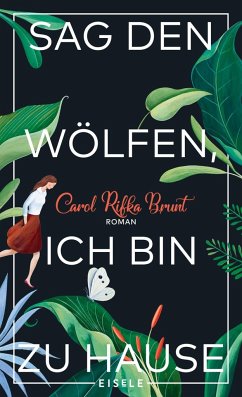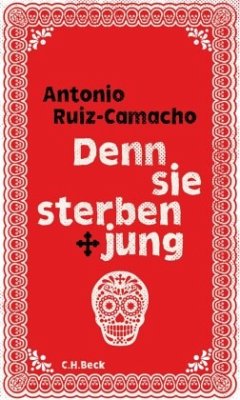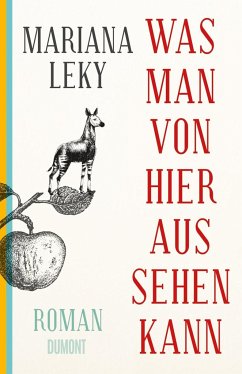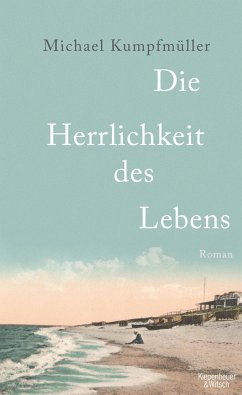nicht Auras Familie: "Esto es tu culpa" - "Das ist deine Schuld", schleudert Auras Mutter Francisco ins Gesicht und lässt Anwälte auf ihn los, um ihn für ihren hilflosen Schmerz bezahlen zu lassen.
Franciscos unbarmherzigster Ankläger ist er allerdings selbst: untätig lesend hatte er am Strand gesessen, als Aura in die Welle schwamm. Schuldgefühle und Hass, Leugnung und Verzweiflung, Wut und Depression, vergebliche Versuche der Verdrängung und Kompensation - dann Fügung in das Unumkehrbare: Francisco Goldman macht in "Sag ihren Namen" minutiös die psychischen Prozesse von Schmerz und Trauer greifbar. Seine Hauptfiguren sind ein ungleiches Paar: Aura, Tochter eines mexikanischen Provinzpolitikers, wurde als Scheidungskind von einer besitzergreifenden Mutter nach Mexiko-Stadt entführt, auf dem Campus der Nationaluniversität aufgezogen und zum Literaturstudium nach New York geschickt, damit sie es einmal besser hat.
Der Schriftsteller Francisco, Amerikaner mit Wurzeln in Guatemala und Osteuropa, mit Mitte fünfzig noch immer Junggeselle, lebt seit Jahren von den Frauen ungeliebt und, mit Auras Worten, "hässlich wie ein Frosch", in Brooklyn und schlägt sich mit Literaturstipendien oder universitären Lehraufträgen durchs Leben. Zusammengeführt werden sie durch eine öde Literaturlesung in Anwesenheit Salman Rushdies.
In ihrem eher prosaischen Alltags zwischen Lüsternheiten zwielichtiger Hispanistik-Professoren, intrigenreichen Kursen für kreatives Schreiben, Eifersüchteleien und Anfeindungen durch Auras Familie erfahren sie die Gewissheit eines bislang ungeahnten Glücks. Umso unfassbarer ist sein abruptes Ende.
Die Lebensnähe der Darstellung entspringt einer schmerzhaften Realität: Es ist Francisco Goldmans eigene Geschichte und die seiner im Juli 2007 verstorbenen Frau Aura Estrada. Nach ihrem Tod, seinem darauf folgenden Zusammenbruch und einem nach eigenen Angaben sechs Monate währenden Zustand der Volltrunkenheit flieht Francisco Goldman in die Wohnung einer befreundeten Autorin in Berlin und beginnt, seine Erinnerungen an Aura schreibend zu ordnen. Das Resultat dieser am Ende dreijährigen Trauerarbeit entzieht sich einem linearen Bericht. Wie ein Mosaik fügt sich der Text Stück für Stück zusammen. Rückblenden und Kindheitserinnerungen reihen sich an Tagebucheinträge und autobiographische literarische Versuche aus Auras Feder. Immer wieder kreist Francisco Goldman um Auras Tod - und versagt uns seine Schilderung. Diese lädt er sich erst am Ende von der Seele, nachdem er alle Register der dramatischen Retardierung gezogen hat.
Ganz bewusst bedient sich der Autor solcher Mittel des fiktionalen Erzählens - "Say Her Name: A Novel" lautet auch nicht zufälligerweise der Titel, unter dem das Buch auf Englisch vertrieben wird. Und doch geht es ihm dabei nicht um Fiktion, sondern um minutiöse Dokumentation: um die maximal authentische Darstellung des eigenen Erlebens und Empfindens, die mit dem Leser geteilt werden soll. Es ist, als sei hier ein privater Blog zur Literatur, das Facebookprofil zum Roman angeschwollen.
Sicher ist es einer der literarischen Topoi des Okzidents, der verstorbenen Geliebten eine Klage zu widmen. Doch selbst wenn Francisco Goldmans Aura - bis in den fast gleichlautenden Namen hinein - sich darin etwa der Laura Petrarcas oder der Aurélia Nervals annähert, ist ihre literarische Funktion eine vollständig andere. Über das autobiographische Leid hinaus ist die Klage des Autors traditionell stets auch Spiel mit einer Rolle (ob Petrarcas Laura wirklich je existiert hat, ist bis heute eine gern diskutierte Frage unter Gelehrten).
Über ihre individuelle irdische Existenz hinaus repräsentiert die verlorene "auratische" Geliebte die Verkörperung eines höheren Gesetzes, das den "kurzen Traum" des Lebens transzendiert. Das Gegenteil davon geschieht bei Francisco Goldman. Ihm geht es darum, die Unverwechselbarkeit seiner Geliebten und seines eigenen Schmerzes durch intime Details so zu beglaubigen, als blicke man durch ein Schlüsselloch in die Leben anderer Menschen. Die Gier nach Individualität und Authentizität räumt jede Allgemeingültigkeit aus.
Gerade in seinem unbedingten Ehrlichkeitsanspruch erweist sich "Sag ihren Namen" als Vorzeige-Etüden der von Senett beobachteten "Tyrannei der Intimität", die sich hier in ständiger Penetration des Literarischen durch das Private äußert. Die ausgeschlachteten Tagebucheinträge der pubertierenden Aura ("Liebes Tagebuch: Ich trage einen BH!"), die abgedroschene Sentimentalität ihrer Aufzeichnungen als Erwachsene ("Ich bin ein Luftballon, der nie landet, und niemand greift nach der Schnur, um mich an sich zu ziehen") haben angesichts ihrer mangelnden literarischen Qualität offenbar den einzigen Zweck, als Trophäen aus der Feder der verstorbenen Geliebten ihr Bild dokumentarisch abzupausen.
Dies gilt umso mehr für Auras dürftige erzählerische Versuche, die, dem Zitierten nach zu schließen, am selben Defekt kranken wie Francisco Goldmans eigenes Schreiben: die Form des Erzählens nur zu verwenden, um die eigenen seelischen Gebrechen und biographischen Traumata zu bewältigen.
Mit Literatur hat all das letztlich wenig zu tun. Im "New Yorker" hat Francisco Goldman bereits über dasselbe Erlebnis, illustriert mit Fotos, in einer reportagehaften "personal history" mit dem Titel "The Wave" berichtet. Im Internet finden sich gleich mehrere Aura-Estrada-Gedenkseiten, geschmückt mit Texten von Francisco Goldman. Ja, es gibt sogar ein Aura-Estrada-Gedenkstipendium für debütierende Schriftstellerinnen, die allesamt das Los der Verstorbenen evozieren. Der Trauerfall ist im Zeitalter seiner medialen Reproduzierbarkeit angekommen. Francisco Goldmans privater Aura-Verlust und sein künstlerischer im Sinne Benjamins fallen dabei in tragischer Ironie zusammen.
FLORIAN BORCHMEYER
Francisco Goldman: "Sag ihren Namen". Roman.
Aus dem Spanischen von Roberto de Hollanda. Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 464 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2013