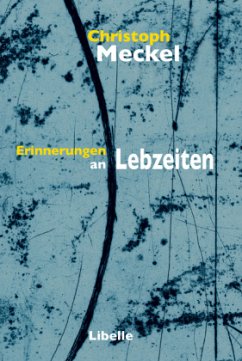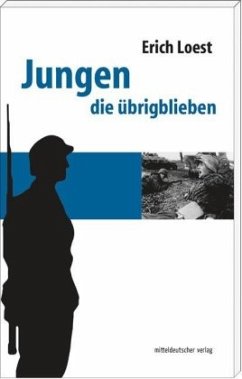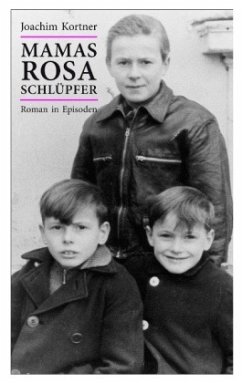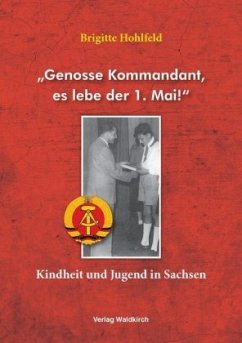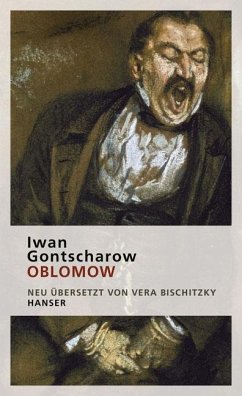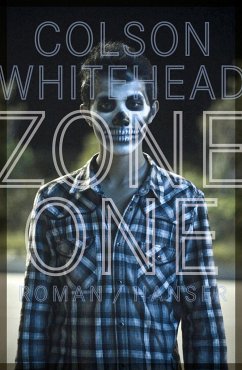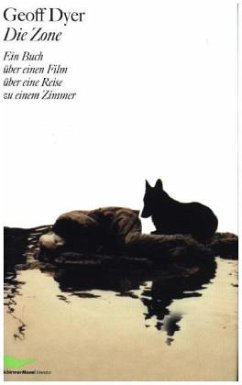Nicht lieferbar
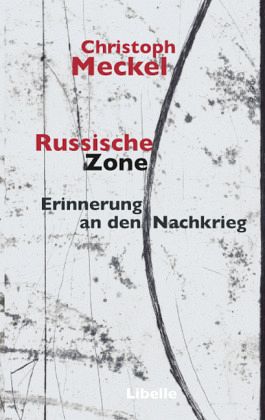
Russische Zone
Erinnerung an den Nachkrieg
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Christoph Meckel ruft sich Bilder zurück, die dem Zehnjährigen fürs Leben bezwingend wurden. Ein Weiterleben nach den Bombenangriffen, im Haus der Großeltern in Erfurt: von der kurzen Präsenz der Amerikaner und der längeren Besetzung durch die Russen bis hin zur abenteuerlichen Flucht mit der Mutter über die grüne Grenze im Sommer 1947. Ein Kind im Nachkriegsalltag zwischen anarchischen Freiräumen, unvorhersehbaren Unglücken und dem Zwang der Besatzer; mit überforderten Erwachsenen, die mit Flüchtlingen, dem Eindringen der 'Razzia' und den Deportationen zurechtkommen müssen. Noch ...
Christoph Meckel ruft sich Bilder zurück, die dem Zehnjährigen fürs Leben bezwingend wurden. Ein Weiterleben nach den Bombenangriffen, im Haus der Großeltern in Erfurt: von der kurzen Präsenz der Amerikaner und der längeren Besetzung durch die Russen bis hin zur abenteuerlichen Flucht mit der Mutter über die grüne Grenze im Sommer 1947. Ein Kind im Nachkriegsalltag zwischen anarchischen Freiräumen, unvorhersehbaren Unglücken und dem Zwang der Besatzer; mit überforderten Erwachsenen, die mit Flüchtlingen, dem Eindringen der 'Razzia' und den Deportationen zurechtkommen müssen. Noch in den Szenerien des Schreckens regt sich die Utopie eines freieren Daseins. Auf den letzten Seiten setzt der Autor seine Erinnerungen auf eine neue Spur: die seiner Aneignung russischer Dichtung ('Nachricht für Baratynski'), in deren Mitte er seine Begegnung mit Paul Celan als Übersetzer von Jessenin, Blok und Mandelstam im Paris der 50er-Jahre rückt.