Nicht lieferbar
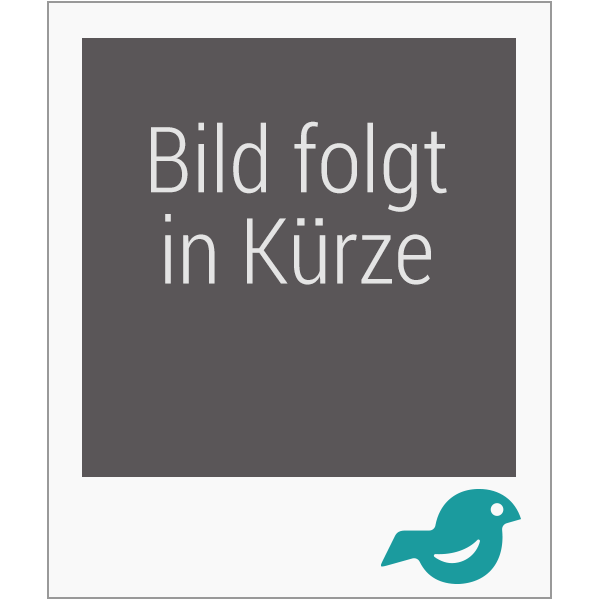
Rudolf Bahro - Glaube an das Veränderbare
Eine Biographie. In Zus.-Arb. mit d. Heinrich-Böll-Stiftung
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Rudolf Bahro ist eine der markantesten und zugleich umstrittensten Personen der jüngeren deutschen Zeitgeschichte - ein Philosoph, der aus der Enge der DDR heraus radikal systemkritisch sowie global und ökologisch gedacht hat. Bekannt wurde er 1977 durch sein Buch "Die Alternative", eine Abrechnung mit dem System der "organisierten Verantwortungslosigkeit" im "realexistierenden Sozialismus", für die er ins Gefängnis nach Bautzen kam. Nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik entwickelte sich Bahro zu einem Vordenker der Öko- und Friedensbewegung sowie zum fundamentalen Kritiker eine...
Rudolf Bahro ist eine der markantesten und zugleich umstrittensten Personen der jüngeren deutschen Zeitgeschichte - ein Philosoph, der aus der Enge der DDR heraus radikal systemkritisch sowie global und ökologisch gedacht hat. Bekannt wurde er 1977 durch sein Buch "Die Alternative", eine Abrechnung mit dem System der "organisierten Verantwortungslosigkeit" im "realexistierenden Sozialismus", für die er ins Gefängnis nach Bautzen kam. Nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik entwickelte sich Bahro zu einem Vordenker der Öko- und Friedensbewegung sowie zum fundamentalen Kritiker einer Arbeits- und Lebensweise, die nach seiner Auffassung die Menschheit immer schneller an den Rand des Abgrunds führt. 1989 ging er in den Osten Deutschlands zurück, um theoretisch und praktisch an der Entwicklung gesellschaftlicher Alternativen mitzuwirken. Dazu gehörte die Gründung einer Landkommune in Sachsen und die Beschäftigung mit spirituellen Strömungen. Genau 25 Jahre nach Erscheinen seines wel tweit erfolgreichen Buches "Die Alternative" legen die Autoren nun die erste Bahro-Biographie vor. Der Berliner Philosoph Guntolf Herzberg und der Schweizer Journalist Kurt Seifert sind ausgewiesene Kenner der Arbeiten Bahros. Sie zeichnen anhand einer Fülle von schriftlichen Materialien und Aussagen von Zeitzeuginnen und -zeugen detailliert den an Brüchen und Widersprüchen reichen Lebensweg Bahros durch die Nachkriegsgeschichte der beiden deutschen Staaten nach. Die Biographie zeigt Rudolf Bahro nicht nur als politischen Akteur und als Wissenschaftler, sondern beleuchtet auch seine Lebensweise und seine vielfältigen, oft konfliktreichen persönlichen Beziehungen.



