der Stalinzeit sind, zeigt der gerade stattfindende, menschenverachtende Prozess gegen Alexej Malobrodski: Vorher kerngesund, erkrankte er in der Untersuchungshaft und brach vor Gericht zusammen. Er solle keinen "Zirkus" veranstalten, schnauzten ihn die Wachen an (F.A.Z., vom 14. Mai). Der Direktor des Moskauer Gogol Centers und dessen künstlerischer Leiter, der Regisseur Kirill Serebrennikow, hatten sich der Missachtung der offiziellen Kulturlinie schuldig gemacht und weder den neuen KGB-Machthabern noch dem erstarkenden, aggressiven "Neu-Russland" gehuldigt.
Viele solche Verhaftungen hatte Solomon Richter, der eindrucksvolle Held von Maxim Kantors Roman, miterlebt. Er liegt im Sterben, ist aber die klarste und stärkste Stimme des Buches - und eine Hommage an Maxim Kantors Vater. In Solomons armseligem Krankenzimmer hallt der beginnende Krieg in der Ukraine nach, eine propagandistische Farce, über die ständig im Fernsehen berichtet wird. Ein Pfleger schwadroniert über seine angeblichen Heldentaten und die des Kommandeurs Jakow Deschkow - dessen Vater ein Jugendfreund Richters war.
Wie ein gigantisches Drama ist dieser Roman gebaut: Das Scheitern der Revolution bildet den ersten Akt, auf ihn folgen Stalins Terror und der Weltkrieg als zweiter Akt. Nach einem kurzen Zwischenspiel, eingeleitet von neuen Säuberungen und gekrönt von einer trügerischen Hoffnung auf Demokratie, führt der Ukraine-Krieg als niederschmetternder dritter Akt an den Anfang zurück. Illusionslos, eigensinnig und spöttisch beobachtet Solomon seine Umgebung, melancholisch lässt ihn nur "die größte Niederlage des vergangenen Jahrhunderts" werden, die Vernichtung der sozialistischen Idee. An ihre Stelle sei "die schwarze Internationale von Faschismus und Imperialismus" getreten, erklärt er seinem Besucher. Mephisto und Faust stehen sich in dieser programmatischen Szene gegenüber, in der bezeichnenderweise der Sterbende, ein glühender Aufklärer, die Oberhand behält.
Maxim Kantor, 1957 in Moskau geboren, vertrat Russland 1997 auf der Biennale in Venedig und gilt seither als einer der renommiertesten Künstler seines Landes. Dass er auch politisch-philosophischer Essayist ist, merkt man den beiden zentralen Treffen zwischen den Oppositionellen, die sich jetzt "Liberale" nennen, und den neuen Mächtigen, den KGB-Milliardären und Ölmagnaten, an: Sie sind nicht nur funkelnd und lebensecht erzählt, sondern belegen auch die ganze Machtversessenheit dieses im Zeichen von "Blut und Nostalgie" geeinten Reiches. Spielerische Oberfläche bildet jeweils ein Mordfall, der aber nie aufgeklärt wird, da alle Anwesenden ein starkes Motiv haben. Vielleicht handelt es sich ja nur um die Werbemaßnahme eines russischen Galeristen?
Ob Stalins Terror schrecklicher war als der Hitlers will Ernst Hanfstaengl, der zweite, etwas blassere Protagonist, nicht entscheiden. Der historische Förderer Hitlers entpuppt sich als theoriebegeisterter Mephisto, der für imperiale Ideen schwärmt und sich über die korrumpierte russische Intelligenz mokiert. Die deutschen Intellektuellen, vom wankelmütigen Kreisauer Kreis bis zum Parteimitglied Martin Heidegger, der Hannah Arendt in rosa Pantoffeln verfolgt, sieht er nicht positiver.
Besonders eindringlich sind Kantors Bilder vom Krieg, die froststarren Wälder um Rschew, Hölle und verwunschenes Land zugleich. Bizarre, grausame und märchenhaft unwirkliche Szenen wechseln einander ab, Jakow Deschkows Vater und Solomon Richter werden in den Kämpfen der Westfront erwachsen. Deren Väter und Großväter - hohe Militärs die einen, jüdische Gelehrte die anderen - lebten im gleichen Moskauer Haus und wurden Opfer von Stalins Säuberungen. In diesen drei Generationen spiegelt sich, von Kantor präzise und mitreißend erzählt, ein besonders grausames, absurderweise von menschlicher Gleichheit träumendes Jahrhundert.
NICOLE HENNEBERG
Maxim Kantor: "Rotes Licht". Roman.
Aus dem Russischen von Juri Elperin, Sebastian Gutnik, Olga und Claudia Korneev. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2018. 704 S., geb., 29,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
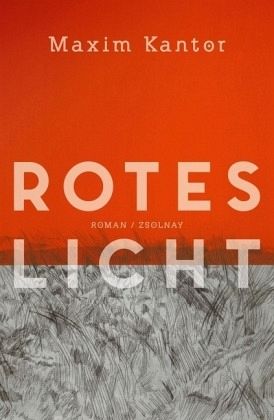



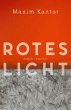

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2018