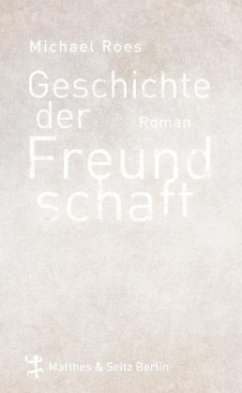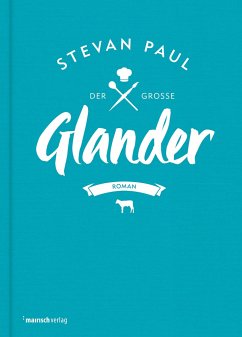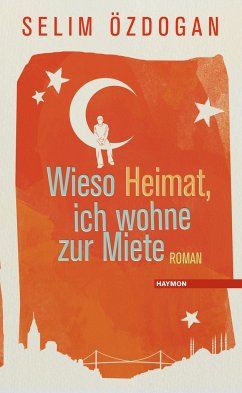der Gastarbeiterepoche, die seit 1968 auch Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien zu Abertausenden nach Deutschland strömen ließ.
Für Mia aus dem zweiten Roman von Jagoda Marinic wird eine solche Kneipe am unfeinen Ende der Brunnenstraße im Berliner Wedding zum Herzstück einer Familiensaga, die sich zwischen Kanada, dem proletarischen Berlin und dem bergigen Hinterland der dalmatinischen Küste bewegt. Als Kind kroatischer Gastarbeiter in Deutschland aufgewachsen, nutzte Mia einen Studienaufenthalt im kanadischen Toronto, um ihre Vergangenheit und die ganze balkanesische Mischpoke elegant loszuwerden: die bleierne Bodenständigkeit der Familie und das graue Deutschland, in dem man auch nach Jahrzehnten noch ewig gefragt wird, wo man herkommt, nur weil der Name nicht klassisch eingeboren klingt.
Im kosmopolitischen Toronto, wo man politisch korrekt frei ist von Indiskretionen zum ethnischen Status, hängt sie das Studium bald an den Nagel und avanciert zur erfolgreichen Fotografin. Nach der ersten großen Vernissage verflüchtigt sich unerwartet die Leichtigkeit des Seins, und eine merkwürdige Leere kommt über sie. Ihr Freund, ganz mit dem Glauben an den pursuit of happiness verwachsen, schickt sie erst zum Therapeuten und danach, als sie schroff ablehnt, empfiehlt er eine Selbsttherapie: Zurück nach Hause, als wäre dieses ,Zurück' ein Ort, der auf einen wartet, der dasteht, selbst wenn man sich verspätet, wie warme Suppe auf Großmutters Herd.
Genauso aber kommt es, als Mia in der Nähe des Rosenthaler Platzes an einem kalten, schneereichen Berliner Januartag eine ungelenke Werbung für einen billigen Mittagstisch entdeckt, die nur von ihrer Tante Zora stammen kann. Wie in einem Puzzle setzt Mia nun aus eigenen Erinnerungen und Erzählungen Zoras die Seelen- und Gefühlslandschaft ihrer Familie und ihrer selbst neu zusammen.
Aus dem trüben Berliner Januarlicht entstehen Bilder der Kindheit im Wedding, der Sommerurlaube im kroatischen Dorf, der Eltern, die als junges Ehepaar nach Deutschland kamen, der Geschwister und der Großmutter, die zwischen Tod und noch nicht tot nicht mehr recht unterscheiden will. Zwischen die Erinnerungsfetzen drängen sich Begegnungen mit alten Bekannten wie Jesús, dem Spanier, der als intellektueller Bohemien in Berlin lebt und inzwischen von Zora mit ihrem schwachen Herzen für hungrige Seelen durchgefüttert wird.
Nach und nach werden Mia die schmerzhaften Leerstellen in der eigenen Gefühlswelt bewusst, die jenem Deutschland geschuldet sind, über das die Eltern nie sprachen, weil es eben nur eine Durchgangsstation war, ein Provisorium. Alles, was sie empfanden, war eine devote Dankbarkeit gegenüber dem Gastland, das nie eine Geste des Dankes zurückschickte. Wo, fragt Mia bitter, ist das Ellis Island Berlins, wo sind die Berliner Geschichten, die leuchten könnten? Gleichzeitig zerfällt das, was in Kanada als Liebe und Halt erschien, vor der Berliner Kulisse zu oberflächlichem Besorgnisstaub.
Hier geht es plötzlich nicht mehr nur um die nordamerikanische Selbstfindung, sondern um komplizierte europäische Geschichten zwischen vielen Kriegen, die wie Schadstoffe vom ungesunden Rauchen in der Lunge kleben bleiben. Was die Teilung und die Wiedervereinigung anbelangt, so scheinen Deutsche und ehemalige Jugoslawen im Konträren doch gleich zu sein. Während die einen nach der Vereinigung zunächst glaubten, sie seien einander zu fremd geworden, um im selben Land zu leben, lamentieren die Völker im ehemaligen Jugoslawien nach dem sie entzweienden Krieg, dass sie einander eigentlich zu ähnlich seien, um in so vielen verschiedenen kleinen Ländern zu leben.
Jagoda Marinic wurde 1977 als Kind kroatischer Eltern im schwäbischen Waiblingen geboren und machte bisher vor allem mit Erzählungen, Essays und Theaterstücken auf sich aufmerksam. Ihr neuer Roman setzt den sogenannten Gastarbeitern aus dem ehemaligen Jugoslawien, die über Nacht zu Serben, Kroaten, Bosniern oder Montenegrinern wurden und über Jahre nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten, ein Denkmal. Das Blutbad in ihrer Heimat verfolgten viele fassungslos vor deutschen Fernsehern und kehrten mit Pässen von neuen Staaten nach Hause zurück.
Eine Freundin eines konventionell an der Handlung klebenden Schreibens ist diese Autorin nicht. Man muss das Buch aufmerksam lesen, um die seelischen Konflikte der Figuren zu entschlüsseln und ein Gefühl zu entwickeln für den Bruch zwischen den Generationen, für jenes Gestern im Heute, das taub mache, wie Mia meint. Wer sich auf die subtile Sprache dieser assoziativ geschriebenen, lyrischen Prosa einlässt, dem wird dies auch gelingen.
SABINE BERKING.
Jagoda Marinic: "Restaurant Dalmatia". Roman.
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2013. 240 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
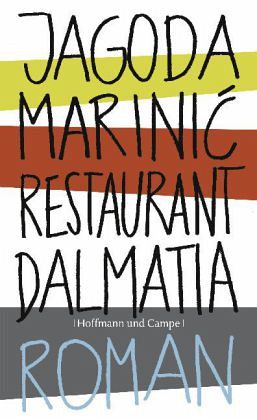





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.09.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.09.2013