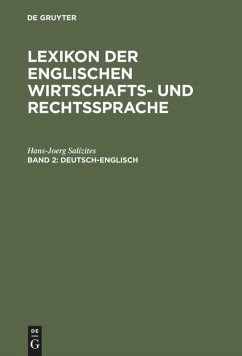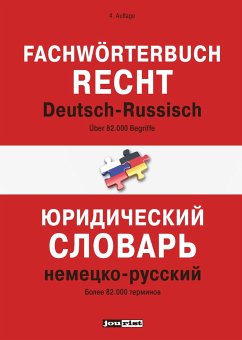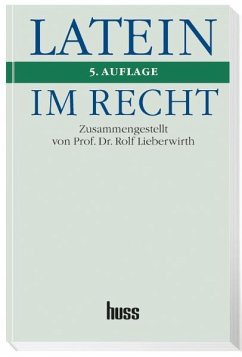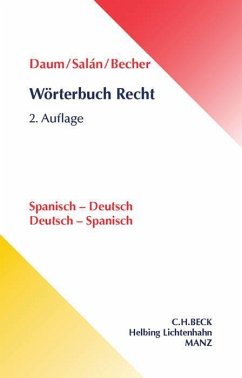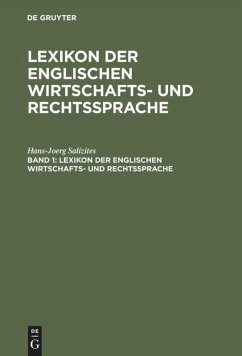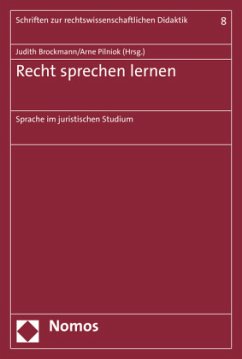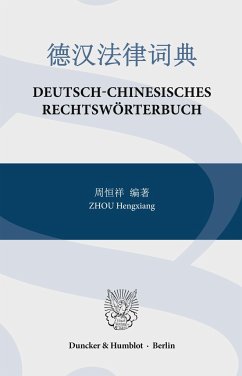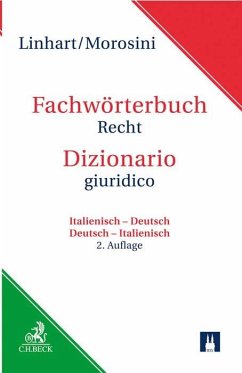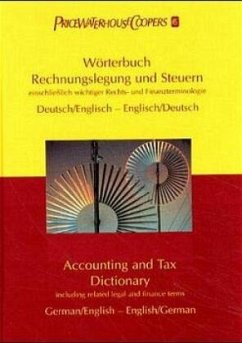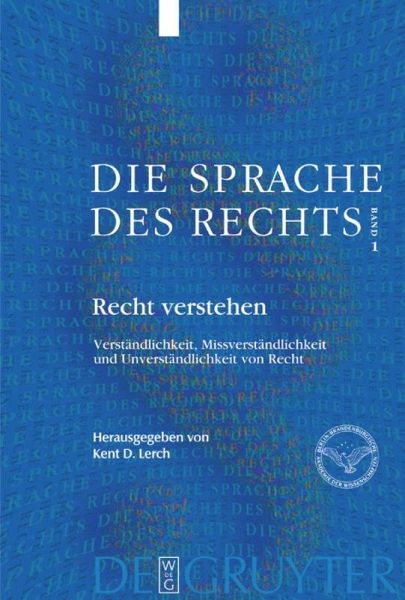
Recht verstehen
Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht
Herausgegeben: Lerch, Kent D.; Lerch, Kent D., Mitarbeit: der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
230,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
An der Sprache des Rechts wird Kritik geübt, seit die Aufklärung die Verständlichkeit der Gesetze zu ihrem Anliegen gemacht hat. Mit den großen Kodifikationen des Rechts im ausgehenden 19. Jahrhundert hat die Kritik am angeblich schlechten, unverständlichen Juristendeutsch eine besondere demokratietheoretische Legitimation bekommen. Diese Sprachkritik sucht seit den siebziger Jahren vermehrt bei der Linguistik Rat, wie denn eine bessere Allgemeinverständlichkeit von Rechtstexten verwirklicht werden könnte. Der Band versammelt systematisch aufeinander bezogene Beiträge ausgewiesener Lin...
An der Sprache des Rechts wird Kritik geübt, seit die Aufklärung die Verständlichkeit der Gesetze zu ihrem Anliegen gemacht hat. Mit den großen Kodifikationen des Rechts im ausgehenden 19. Jahrhundert hat die Kritik am angeblich schlechten, unverständlichen Juristendeutsch eine besondere demokratietheoretische Legitimation bekommen. Diese Sprachkritik sucht seit den siebziger Jahren vermehrt bei der Linguistik Rat, wie denn eine bessere Allgemeinverständlichkeit von Rechtstexten verwirklicht werden könnte. Der Band versammelt systematisch aufeinander bezogene Beiträge ausgewiesener Linguisten, Juristen und Schriftsteller zur Problematik des Verständnisses juristischer Sprache, zur Methodik empirischer Verständlichkeitsmessung und zu den Möglichkeiten transdisziplinärer Kooperation zwischen Rechts- und Sprachwissenschaftlern.