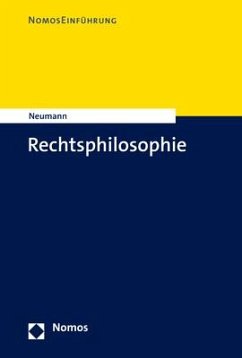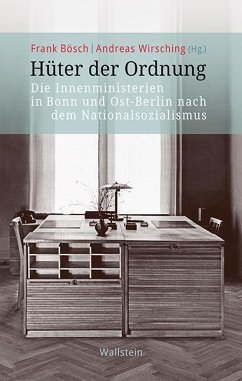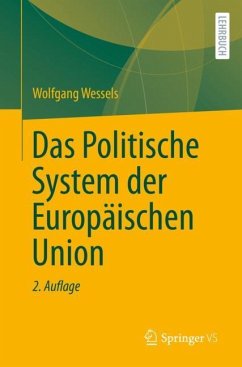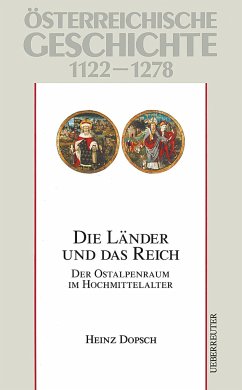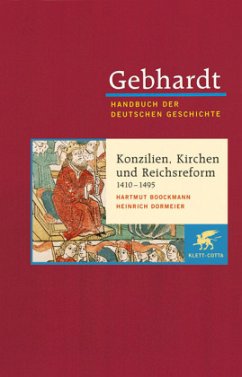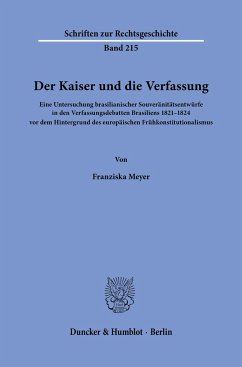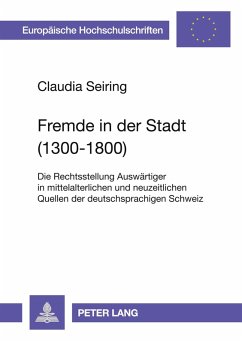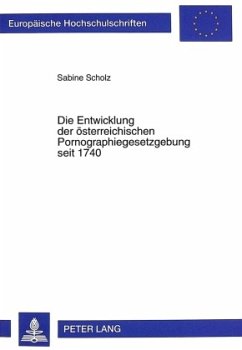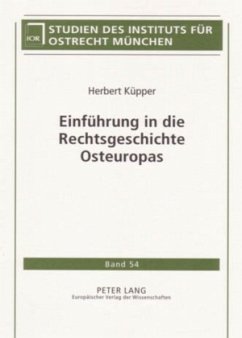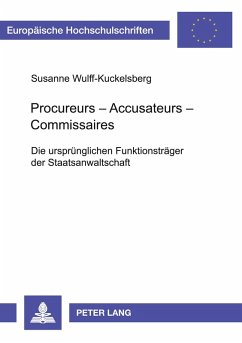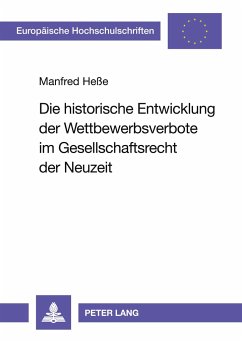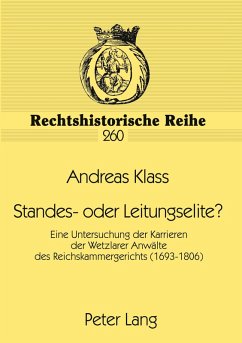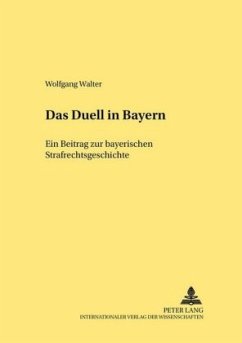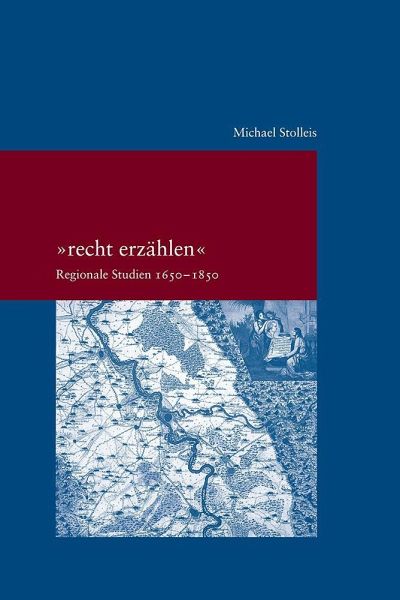
"recht erzählen"
Regionale Studien 1650-1850
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
28,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wer "recht erzählt", bewegt sich im Grenzgebiet zwischen wissenschaftlicher Arbeit und fiktiver Narration. Die in Quellen überlieferte Ausdrucksweise historischer Akteure nicht zu verfälschen und sie als Rechtsgeschichte(n) den eigenen Zeitgenossen zu vermitteln, ist ein Balanceakt. Michael Stolleis wählt in diesem Band den Weg über anschauliche Einzelfälle, die sich zu einem pfälzischen Panorama fügen. Der Bogen der an Rhein und Neckar angesiedelten regionalen Studien erstreckt sich von der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert. Uns begegnen pfälzische Hochzeitsleute, Frankfurter J...
Wer "recht erzählt", bewegt sich im Grenzgebiet zwischen wissenschaftlicher Arbeit und fiktiver Narration. Die in Quellen überlieferte Ausdrucksweise historischer Akteure nicht zu verfälschen und sie als Rechtsgeschichte(n) den eigenen Zeitgenossen zu vermitteln, ist ein Balanceakt. Michael Stolleis wählt in diesem Band den Weg über anschauliche Einzelfälle, die sich zu einem pfälzischen Panorama fügen. Der Bogen der an Rhein und Neckar angesiedelten regionalen Studien erstreckt sich von der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert. Uns begegnen pfälzische Hochzeitsleute, Frankfurter Juristen, Seidenbauern, Migrantenschicksale und der obrigkeitliche Umgang mit Bettlern in der Kurpfalz. Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Bayern und der Pfalz entlud sich u.a. im pfälzisch-badischen Aufstand (1849). Dass unter den Revoltierenden ein Neustadter Seiler namens Georg Stolleis auftaucht, ist nur ein überraschendes Detail dieser reichhaltigen Erzählungen vom Recht.Anyone engaged in "narrating the law" moves in the border area between scientific work and fictional narration. In order to circumvent the danger of distorting the expression of historical actors handed down in the sources and to convey them as legal history(s) to one's own contemporaries calls for a balancing act. In this volume, Michael Stolleis chooses the path of vivid individual cases that combine to form a Palatine panorama. The arc of the regional studies set on the Rhine and Neckar stretches from early modern times to the 19th century. We encounter Palatine wedding couples, Frankfurt lawyers, silk farmers, the fates of migrants and the way the authorities dealt with beggars in the Electoral Palatinate. The tense relationship between Bavaria and the Palatinate came to a head in the Palatinate-Baden uprising (1849). The fact that a Neustadt ropemaker named Georg Stolleis appears among the revolters is only one surprising detail of these rich narratives of the law.