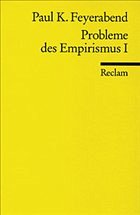
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Paul Feyerabend ist durch sein Diktum "Anything goes" berühmt geworden. Damit ist seine Philosophie aber keineswegs erschöpfend charakterisiert. Die hier erstmals ins Deutsche übersetzte Schrift von 1965 offenbart wesentliche Aspekte seines Denkens: Mythologie, Kosmologie und Metaphysik sind als Erklärungsmodelle "erlaubt", während ein radikaler Empirismus zu verwerflichem "theoretischen Monismus" führt. Feyerabends Schrift scheint heute moderner als zu ihrer Entstehungszeit.
Paul K. Feyerabend (1924-94) lehrte Philosophie und Wissenschaftstheorie u.a. in Berkeley, London und Zürich.
Produktdetails
- Reclams Universal-Bibliothek 18139
- Verlag: Reclam, Ditzingen
- Seitenzahl: 261
- Deutsch
- Gewicht: 117g
- ISBN-13: 9783150181393
- ISBN-10: 3150181399
- Artikelnr.: 09845074
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Dass alles Wissen aus der Erfahrung stammt - dieser Grundsatz des Empirismus überzeugte im letzten Jahrhundert vor allem jene Naturwissenschaftler, denen die Philosophie nicht exakt genug war. Der "fröhliche Wissenschaftler" Paul Feyerabend (1924-1994), unter anderem in Berkeley, Zürich, London, Yale lehrend, untersuchte diesen Grundsatz in einer detaillierten Abhandlung aus 1965. Sie ist nun erstmals in deutscher Übersetzung von Volker Böhnigk und Rainer Noske präsent. Die in Bonn und Euskirchen lebenden Kollegen belegen in ihrem ausführlichen und gut begreiflichen Nachwort etwa Feyerabends anhaltend populäres Diktum "anything goes": alles sei erlaubt, so es nur einen Forschungsertrag zeitige. Die Beschränkung des Empirismus erschien dem wohl wichtigsten Kritiker zeitbezogener Erkenntnistheorien als entschieden zu eng, resümieren Böhnigk/Noske. Praxis und tatsächliche Methoden der Wissenschaften seien wesentlich vielfältiger als starre Grundsätze, welche die Philosophen den Wissenschaften unterstellten. Und aus dieser Einsicht heraus entwickelte Paul Feyerabend sein liberales wie radikal pluralistisches Denken. Generalanzeiger
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.02.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.02.2002Richtig schlimm wird's vor dem Kino
Woher kommt die kontinuierliche und zahlenmäßig beträchtliche Zunahme des Alleinlebens, und wie geht ein entsprechender Alltag vonstatten? Die Frage hat in der soziologischen Literatur etliche Spezialstudien hervorgerufen, sie dient als Ausgangspunkt für Bücher der feministischen Theorienbildung und produziert nicht nur bei Demographen einen Alarmismus moralischer und ökonomischer Art, der die Erkenniserwartung eher enttäuscht als erfüllt. Unbefriedigend bleibt, wie einlinig diese ebenso interessante wie voraussetzungsreiche Fragestellung in der Regel behandelt wird: Entweder verzettelt man sich - etwa bei der Auswertung von Tonbandaussagen oder Briefen - oft grob psychologisierend im
Woher kommt die kontinuierliche und zahlenmäßig beträchtliche Zunahme des Alleinlebens, und wie geht ein entsprechender Alltag vonstatten? Die Frage hat in der soziologischen Literatur etliche Spezialstudien hervorgerufen, sie dient als Ausgangspunkt für Bücher der feministischen Theorienbildung und produziert nicht nur bei Demographen einen Alarmismus moralischer und ökonomischer Art, der die Erkenniserwartung eher enttäuscht als erfüllt. Unbefriedigend bleibt, wie einlinig diese ebenso interessante wie voraussetzungsreiche Fragestellung in der Regel behandelt wird: Entweder verzettelt man sich - etwa bei der Auswertung von Tonbandaussagen oder Briefen - oft grob psychologisierend im
Mehr anzeigen
Labyrinth der Einzelbefunde, oder man greift ohne hinreichende Absicherung durch Belege in den Sternenhimmel der Theorie. Im reich ausgestatteten Kosmos der Beziehungs- und Single-Literatur fehlte bisher die Studie, von der man den Eindruck hätte, sie würde die höchst individuellen Erwägungen, die dieser Thematik innewohnen, mit den gesellschaftlich wirksamen Mechanismen und - wenn man so will - allgemein anthropologischen Erwägungen zu einem fundierten Ganzen zusammenfügen. Der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann gehört sicherlich zu denen, von denen man noch am ehesten erwartet hätte, daß sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Aspekten von Paarbeziehungen und Familienleben und hat dabei stets einen originellen, die Schemata sprengenden Zugriff gefunden. Das zeigen seine Bücher "Schmutzige Wäsche" (wann wird das Bügelbrett zum Krisenherd?), "Frauenkörper - Männerblicke" (wer darf sich "ohne oben" sonnen?), "Mit Leib und Seele" (warum waschen, ordnen, schrubben wir so und nicht anders?). Schon die treffsichere Wahl dieser Aspekte, mit der Kaufmann der conditio humana gehaltvoll auf die Schliche zu kommen sucht, demonstriert nicht nur den gebührenden Umfang an Lebenserfahrenheit, sondern läßt den Autor auch als einen Meister des verhalten-humorvollen Tons hervortreten, wie er für die genaue Beobachtung des Menschlichen nun einmal absolut erforderlich, in der Soziologie aber leider relativ selten zu finden ist. Nun wartet Kaufmann mit einem in der Tat bahnbrechenden Werk über das Single-Dasein auf, das seit wenigen Tagen auch in der deutschen Übersetzung vorliegt ("Singlefrau und Märchenprinz". Über die Einsamkeit moderner Frauen. UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2002. 271 S., br., 24,- ). Im Zentrum steht die Solo-Existenz der Frau, aber so weit sind die Geschlechter nicht voneinander entfernt, daß sich hier nicht auch der Mann in den Mechanismen des Alleinseins "wiedererkennen" würde, so der Autor, "die jedoch auf weiblicher Seite wie durch ein Vergrößerungsglas zu beobachten" seien. Gestützt auf die Auswertung von dreihundert Briefen an die Zeitschrift "Marie-Claire" geht es um Orte des Unbehagens für Singles (die Warteschlange vor dem Kino etwa, in der man zwischen Glück demonstrierenden Paaren auszuharren hat); um die Ambivalenz des regressiven Rückzugs ins Bett, ins Bad und in die eigenen vier Wände überhaupt; um das von Visionen des Traummanns/der Traumfrau begleitete Ritual des "Ausgehens"; um die Oasen in der sexuellen Wüste; und schließlich und zuvörderst um all die inneren Tumulte, die die Suche nach Selbstsicherheit einer "autonomen", dabei aber das Familienbild nie ganz aus dem Auge verlierenden Existenz hervorbringt. Kaufmann versteht es glänzend, in seinen Steilhängen und in seinen Abgründen das experimentelle Lebensgefühl zu beschreiben, dem die Single-Existenz ausgesetzt ist: den gesteigerten Druck der Selbstreflexion, der das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der eigenen, vermeintlich empirisch gewonnenen Kategorien tagtäglich neu unterminiert, und der das Leben zumindest im Kopf zu einer "Revolution in Permanenz" macht (die Weiterungen der Problematik des anything goes finden sich, jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt, bei Paul K. Feyerabend: "Probleme des Empirismus I", Reclam Verlag, Stuttgart 2002, 261 S., br., 7,10 ). Die glücklichsten Ehen, so Kaufmanns Expertise, werden denn auch von jenen Singles geschlossen, die Ihr Ja-Wort als eine "Setzung" durchschauen, das seinen Bestand nicht abhängig macht von der wechselvollen Empirie der Gefühle. Womit die Weisheit der Marie-Claire-Leser erwiesen wäre.
CHRISTIAN GEYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
CHRISTIAN GEYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Auch wenn es heute still geworden ist um den 1994 verstorbenen Philosophen Paul Feyerabend, gehören seine Arbeiten nach Einschätzung des Rezensent Manfred Geier noch immer zu den besten Darstellungen der wissenschaftlichen Praxis. Mit "Probleme des Empirismus" liegt Feyerabends bereits 1965 erschienene Arbeit zur Wissenschaftstheorie in einer deutschen Übersetzung vor. Geier findet darin Feyerabends grundlegende Einsichten, die er später entfaltete und radikalisierte. Unübersehbar sei dabei aber auch, dass die Stichworte von Popper souffliert wurden. Geier versteht Feyerabends Plädoyers für einen "theoretischen Pluralismus", für eine "Revolution in Permanenz", für die Bedeutungsänderung von Begriffen uswund so weiter als Ausführungen von Popperschen Ansätzen. Damit stellen Feyerabends "Probleme des Empirismus" nach Ansicht von Geier nicht nur eine Etappe Feyerabends auf dem Weg zum Anarchisten dar, sondern markieren auch ein Stadium in seinem Schaffen, in dem er sich noch zu seinem Lehrer Popper bekannte, bevor er ihn zu attackieren begann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


