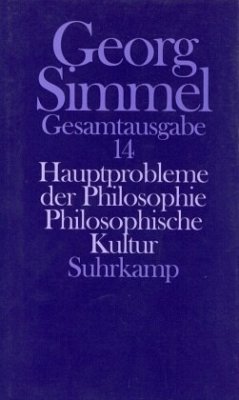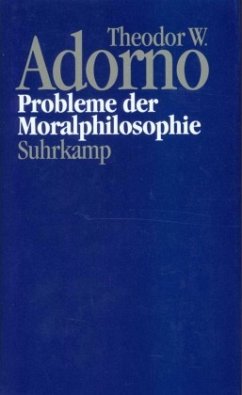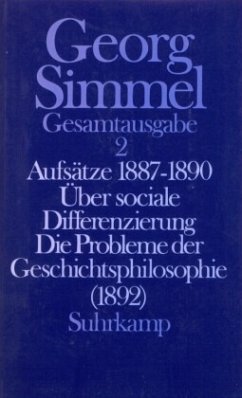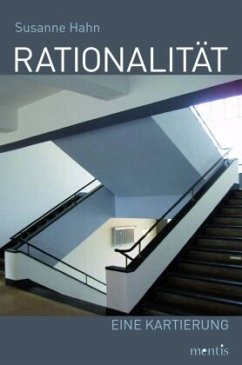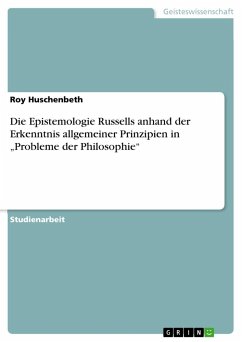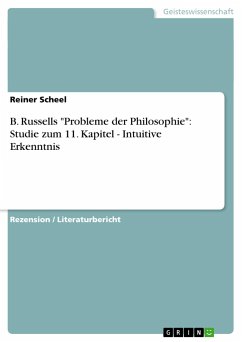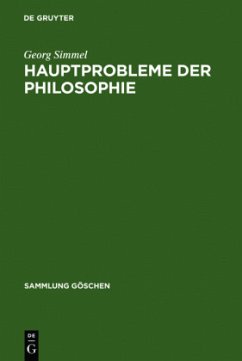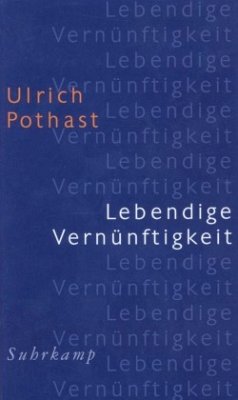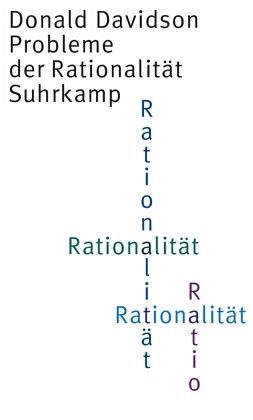
Probleme der Rationalität
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Seit den frühen 1960er Jahren bis zu seinem Tod im Sommer 2003 war Donald Davidson der wohl einflußreichste Philosoph englischer Sprache. Mit Probleme der Rationalität liegt nun der vierte Band seiner philosophischen Schriften in deutscher Übersetzung vor und mit ihm eine weitere Etappe auf Davidsons Weg zu »einer einheitlichen Theorie des Denkens, der Bedeutung und des Handelns«. Der so betitelte Aufsatz bildet zugleich das programmatische Epizentrum dieses Bandes. Rationalität, so Davidsons Generalthese, ist dabei eine notwendige Bedingung, um das Denken, Sprechen und Handeln anderer ...
Seit den frühen 1960er Jahren bis zu seinem Tod im Sommer 2003 war Donald Davidson der wohl einflußreichste Philosoph englischer Sprache. Mit Probleme der Rationalität liegt nun der vierte Band seiner philosophischen Schriften in deutscher Übersetzung vor und mit ihm eine weitere Etappe auf Davidsons Weg zu »einer einheitlichen Theorie des Denkens, der Bedeutung und des Handelns«. Der so betitelte Aufsatz bildet zugleich das programmatische Epizentrum dieses Bandes. Rationalität, so Davidsons Generalthese, ist dabei eine notwendige Bedingung, um das Denken, Sprechen und Handeln anderer interpretieren, d. h. verstehen zu können, und sie spielt eine tragende Rolle bei der Frage, welchen Wesen wir überhaupt einen Geist zusprechen können. In weiteren Abhandlungen wendet Davidson diese These etwa auf die Frage nach der Objektivität der Werte an, fragt sich, ob es eine »Wissenschaft der Rationalität « geben könne, und liefert eine scharfsinnige Analyse von »Turings Test«. Den krönendenAbschluß bilden die berühmten Aufsätze über Irrationalität.Der Band, den der Autor nicht mehr selbst zum Abschluß bringen konnte, wird von seiner Frau Marcia Cavell eingeleitet und schließt mit einem bewegenden Interview, das Ernie Lepore mit Donald Davidson über dessen Leben und Werk geführt hat.