langfristige Ziele zu verfolgen. Klar ist jedenfalls, wie man Wohlstand verhindert: indem man es attraktiv macht, andere kriminell und/oder politisch auszubeuten, also zu nehmen, statt etwas zu unternehmen oder zu produzieren.
Es waren Beobachtungen dieser Art, die Olson zur politischen Ökonomie und damit zu seiner berühmten "Logik des kollektiven Handelns" (1965) führten. Die Ökonomie müsse die politische Ordnung berücksichtigen, und die Politikwissenschaft könne die Wirtschaft nicht aussparen, schreibt er in seinem letzten Buch. Doch sei die Wissenschaft diesem Anspruch bis vor kurzem nicht gerecht geworden. Die Politikwissenschaftler hätten vergeblich auf eigene Faust nach dem Gral, einer reinen Theorie der Macht, gesucht, die Ökonomen indes hätten einfach das Marktmodell auf das politische Handeln ausgedehnt. Dabei sei aber die Logik der Macht nicht in den Blick gelangt.
An dieser Stelle muß man Olson korrigieren, damit sein Argument voll und ganz zur Geltung kommt. Was er über die Unzulänglichkeit früherer ökonomischer Theorien der Politik sagt, gilt auch noch für den Olson von 1965. Das Problem bestand keineswegs in der Anwendung des Marktmodells, sondern darin, daß man im Stil der neoklassischen Ökonomie nur die freiwillige Zusammenarbeit rationaler nutzenmaximierender Individuen sah und nicht erklären konnte, wie überhaupt eine politische Macht entstehen sollte, die in der Lage wäre, Regeln durchzusetzen. Olsons bleibende Leistung bestand darin, daß er diesen Ansatz konsequent zu Ende dachte und ihn ad absurdum führte. Es ist nicht möglich, die klassische Vertragstheorie einfach in ökonomische Theorie zu übersetzen. Die Vereinbarung zweier Vertragspartner unterscheidet sich grundlegend von der Logik der Politik oder des kollektiven Handelns. Im ersten Fall arbeiten beide zusammen, weil nur so das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Im zweiten Fall jedoch geht es um Kollektivgüter, und dabei entsteht eine andere Logik: jene der Trittbrettfahrer. Deshalb ist es für den einzelnen nicht rational, zu kooperieren. Olson hat damals jene Grenze markiert, über die eine neoklassische ökonomische Theorie der Politik ebensowenig hinausgelangt wie eine auf das Thema des Interessenausgleiches fixierte Politikwissenschaft. Er konnte aber selbst noch nicht den Weg von der Logik individueller Zusammenarbeit zur Theorie der Institutionen - oder von der Nachfrage zum Angebot - zeigen, weil er innerhalb dieser Voraussetzungen argumentierte. Dreißig Jahre später hat er eine evolutionäre Theorie der politischen Macht und des Gewaltmonopols formuliert, also die Logik des unternehmerischen Handelns durch jene des Beutenehmens ergänzt. Diese Genealogie der Herrschaft führt zunächst zur illegitimen Abstammung der Machthaber zurück und erklärt deren allmähliche relative Zivilisierung aus zunehmender Erkenntnis ihrer eigenen Interessen - und die Fügsamkeit der Untergebenen aus deren Bewertung der Alternativen.
Anders als der Taschendieb und der Räuber, die ihr Gewerbe im Herumziehen ausüben, entwickelt der seßhaft gewordene Raubritter, der chinesische War-Lord oder der Mafia-Boß eine Langzeit-Perspektive. Wenn er seinen Opfern Schutz anbietet, meint er das ernst, denn er möchte sie dauerhaft ausbeuten, ohne mit andern zu teilen. Daher hält er Konkurrenten fern, errichtet also in seinem Gebiet ein Gewaltmonopol und versucht, die Ausbeutung zu optimieren. Er zielt darauf, seinen Opfern so viel vom Ertrag ihrer Arbeit zu lassen, daß sie ein Interesse an der Steigerung ihrer Produktivität behalten. Er investiert sogar in öffentliche Einrichtungen, solange dies den gemeinsamen Nutzen zu steigern scheint.
Die Subjekte seiner Herrschaft tauschen definierte Schutzgeldzahlungen an einen Gewalthaber gegen die Gefahr wiederholter Plünderung durch unvorhersehbar viele Banditen. Im Vertrauen auf diese Rechtssicherheit und auf das verbleibende Einkommen beginnen sie ökonomische Phantasie zu entwickeln. Auch sie sind nun an der Dauerhaftigkeit des geregelten Ausbeutungsverhältnisses interessiert. Sorge bereitet nur die Schwachstelle jeder Monarchie oder Diktatur: die Nachfolgefrage, die Gefahr von Diadochenkämpfen und Erbfolgekriegen. Dies erklärt zunächst die Anhänglichkeit an Dynastien, dann die Zufriedenheit mit rechtsstaatlichen Demokratien, und es führt schließlich zur Hoffnung, daß seßhaft, zivilisiert und berechenbar gewordene Banditen zwar in ihrem Gebiet das Gewaltmonopol behalten, zugleich aber, da sie zunehmend konkurrieren, noch zurückhaltender werden.
MICHAEL ZÖLLER
(Professor für politische Soziologie an der Universität Bayreuth)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
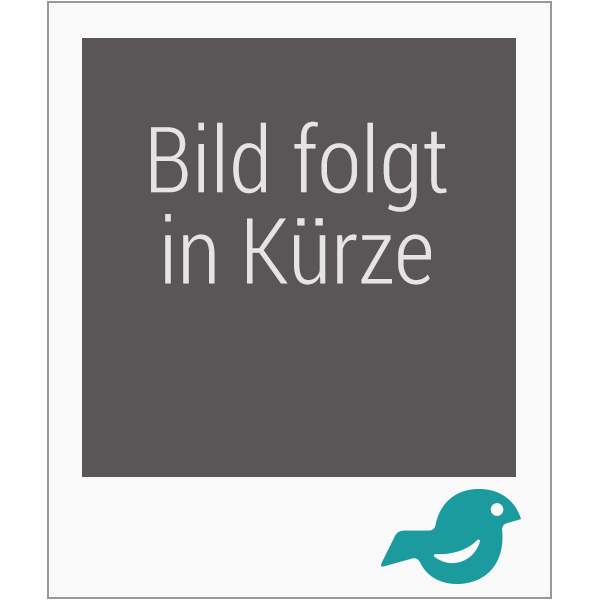




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2001