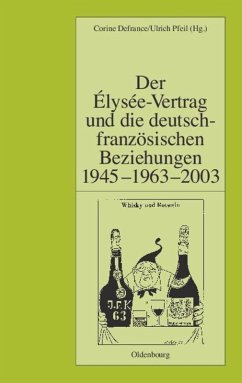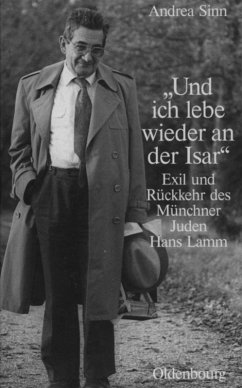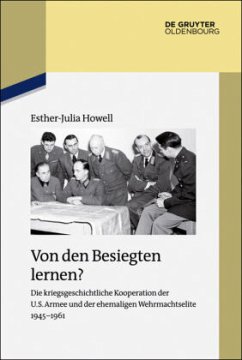als Teil der französischen Besatzungszone dem Retortenland Rheinland-Pfalz zugeschlagen worden. Zwar hat Bayern den Verlust der Pfalz nie ganz verwunden - bis heute gibt es in der Münchener Staatskanzlei einen Pfalzreferenten -, dem Selbstbewußtsein Bayerns tat er jedoch keinen entscheidenden Abbruch. Rückblickend auf eine fast 1500jährige Tradition, mußte Bayern sich 1945 nicht neu erfinden. Nach dem gescheiterten Versuch der Nationalsozialisten, Bayern in mehrere Gaue aufzuteilen, erlebte es 1945 als Freistaat eine Renaissance und spielte neben den Hansestädten Bremen und Hamburg "im innerdeutschen Chaos aufgelöster und neugebildeter Länder" eine bemerkenswerte Sonderrolle. Während Neugründungen wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz erst im Verlauf langjähriger Prozesse zusammenwachsen und zu gemeinschaftsbildenden Traditionen finden mußten, blieb Bayern eine "traditionsarme Stunde" erspart.
Der dritte Sammelband der vom Institut für Zeitgeschichte herausgegebenen Reihe "Bayern im Bund" fragt nach der Bedeutung und Wirkmächtigkeit dieser Traditionen für die Rolle Bayerns im Konzert der Bundesländer. Methodisch geschieht dies vor allem durch den Vergleich mit Nordrhein-Westfalen. Die Landschaften des großen Retortenlands besaßen zwar keine gemeinsame geschichtliche Identität, dafür bildete Nordrhein-Westfalen aber von Anfang an das wirtschaftliche Kernland der Bundesrepublik. Als Bürger eines Landes mußten dessen Bewohner sich erst finden. Damit bildete Nordrhein-Westfalen in vieler Hinsicht einen Gegensatz zu Bayern, gerade darum wurde es von Bayern gleichermaßen als Vorbild und Konkurrenz empfunden.
Bevor der Sammelband in mehrere überaus reizvolle Vergleiche der beiden Länder eintritt, analysiert Petra Weber Struktur und Arbeit der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Sosehr die Landesgruppe außerhalb Bayerns als hartnäckige pressure group bayerischer Interessen wahrgenommen wurde, so entscheidend hat die Landesgruppe daran mitgewirkt, Bayern in die neue Bundesrepublik zu integrieren. Immer war sie bemüht, Bundes- und Landesinteressen gegeneinander auszugleichen, mit dem Ergebnis, daß sie in Bayern selbst und auch von der Staatsregierung oft als zu zentralistisch kritisiert wurde. Dabei haben deren Mitglieder als Abgeordnete wie als Bundesminister erheblichen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg Bayerns. Beispielsweise haben die "Atomminister" Franz Josef Strauß und Siegfried Balke mit großem Erfolg zukunftsträchtige Hochtechnologien nach Bayern gesteuert. Abgesehen von solcher Unterstützung, standen der Bayerischen Staatsregierung keine anderen strukturpolitischen Instrumente zur Verfügung als anderen Landesregierungen auch - in Bayern wurden sie nur konsequenter angewandt, wie die Beiträge über die bayerische Forschungspolitik und die Strategien zur Bewältigung ökonomischer Krisen im westdeutschen Vergleich verdeutlichen.
In den drei Aufsätzen zum Themenkomplex Staatlichkeit, Landesbewußtsein und Geschichtspolitik werden interessante Unterschiede herausgearbeitet. Sie zeigen am Ende aber, daß Bayern und Nordrhein-Westfalen sich im Laufe der Zeit doch erheblich annäherten und auf dem Weg sind, "normale" Länder der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Im Zentrum der gemeinschaftsstiftenden Traditionen Bayerns stand und steht der Staat. Seine Symbole waren auch nach dem völligen Zusammenbruch uneingeschränkt gültig und präsent. Dies galt für die Bayernhymne und die weißblauen Grenzpfähle an den Grenzen zu den östlichen Nachbarstaaten, die nach ihrer Ersetzung durch schwarzrotgoldene Pfähle an die innerdeutschen Grenzen Bayerns umgesetzt wurden. Dies galt vor allem für das bayerische Staatswappen, dessen ehemals pfälzischer Löwe historisch frei zum Symbol der Oberpfalz mutierte. Diese in den altbayerisch-monarchischen Traditionen wurzelnde Identifikation mit Bayern als Ganzem überwölbte erfolgreich auch die internen Spannungen zwischen Bayern, Schwaben, Oberpfälzern und Franken und nahm allen Sezessionsbestrebungen letztlich jede Erfolgschance. Die Staatsregierung hat an der "Niederschrift" einer offiziösen "bayerischen Geschichtserzählung" aktiv mitgewirkt, indem sie sowohl die universitär betriebene Landesgeschichtsforschung als auch Museen und Ausstellungen zur bayerischen Geschichte nachhaltig gefördert hat.
Nordrhein-Westfalen mußte sich dagegen nach 1945 erst in einem langwierigen Prozeß selbst erfinden. Alle Bemühungen der Landesregierung, ein gemeinsames Landesbewußtsein über neue gemeinsame Symbole zu begründen, wurden im Lande lange Zeit eher mißtrauisch betrachtet und angesichts der vordringlichen wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Nachkriegszeit als überflüssig verworfen. Anstelle einer langen gemeinsamen Geschichte wurden die Landschaften an Rhein, Ruhr, Ems und Lippe nach 1945 durch ein Ethos gemeinsamer Arbeit doch auf einen Nenner gebracht. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte machte "NRW" zum Markennamen und gab seinen Bewohnern eine gemeinsame Identität. Während in Bayern die Ministerpräsidenten in der Kontinuität von Königen standen und Elemente monarchischer Repräsentanz in ihr Image übernahmen, gaben sich ihre Düsseldorfer Kollegen mit Ausnahme von Johannes Rau bis heute eher als "erste Kumpel ihres Landes".
Das Rahmenthema "Politik und Kultur im föderativen Staat" wird durch die vorgestellten Beiträge bei weitem nicht ausgefüllt. Mit Hinweis darauf, daß nicht einmal jeder zweite der vorgesehenen Beiträge fertiggestellt worden sei, erklären die beiden Herausgeber diesen Umstand und geben ihrem Wunsch Ausdruck, die vorgelegten Studien möchten weitere Untersuchungen anregen. Diesem Wunsch darf man sich, insbesondere mit Blick auf die Schule und die Künste, getrost anschließen.
MICHAEL HOLLMANN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
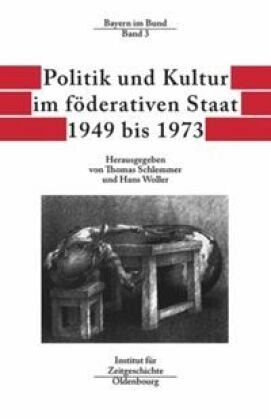




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2005