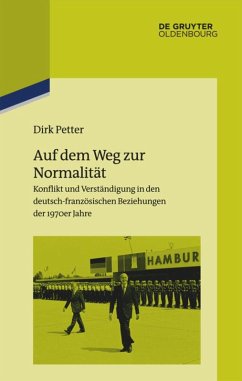Nicht lieferbar

Politik auf dem Land / Bayern im Bund Band 5
Studien zur bayerischen Provinz 1945 bis 1972
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Ölkrise der siebziger Jahre lag eine Periode atemberaubender Veränderungen, die auch die agrarisch-strukturschwachen Regionen Westdeutschlands mit voller Wucht erfassten. Am Beispiel bayerischer Landkreise beleuchtet diese Studie den Strukturwandel der ländlichen Gesellschaft und seine Auswirkungen für die "Politik auf dem Land". Der Autor untersucht das Sozialprofil der politischen Elite, beschreibt das Vordringen der Parteien in die agrarischen Regionen, vor allem die "Landnahme" der CSU und die Schwierigkeiten der SPD, im bäuerlich-klein...
Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Ölkrise der siebziger Jahre lag eine Periode atemberaubender Veränderungen, die auch die agrarisch-strukturschwachen Regionen Westdeutschlands mit voller Wucht erfassten. Am Beispiel bayerischer Landkreise beleuchtet diese Studie den Strukturwandel der ländlichen Gesellschaft und seine Auswirkungen für die "Politik auf dem Land". Der Autor untersucht das Sozialprofil der politischen Elite, beschreibt das Vordringen der Parteien in die agrarischen Regionen, vor allem die "Landnahme" der CSU und die Schwierigkeiten der SPD, im bäuerlich-kleinstädtischen Milieu Fuß zu fassen, und analysiert die politische Praxis sowie die Handlungsspielräume von Kommunalpolitikern. Der Blick von unten ergänzt die Geschichte der Bundesrepublik um ein wichtiges Kapitel, nämlich die enorme Veränderung der ländlichen Gesellschaft im Zuge des "Wirtschaftswunders"; er zeigt aber auch, dass das Land - allen Umbrüchen zum Trotz - einen Teil seines "Eigensinns" behalten hat. Jaromír Balcar Dr. phil. Geboren 1966 in München. Studium der Neueren und Neuesten Geschichte, Geschichte Ost- und Südosteuropas, der Politischen Wissenschaft und der Slawistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der Staatlichen Universität Wolgograd. Von 1996 bis 1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München. Von 1999 bis 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München.