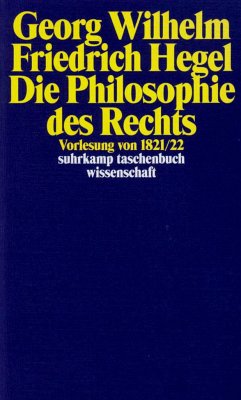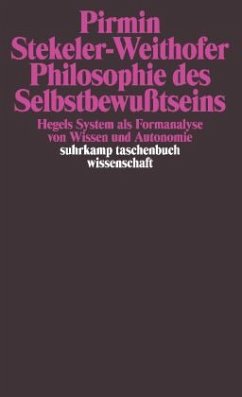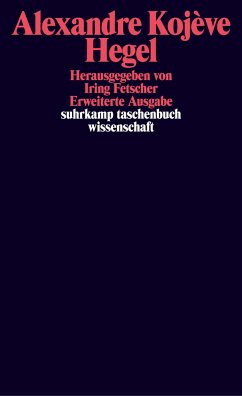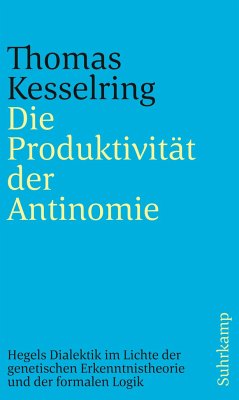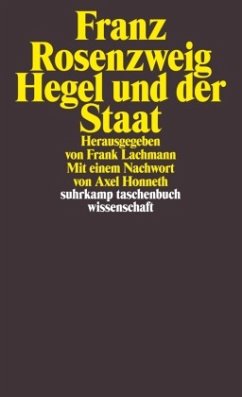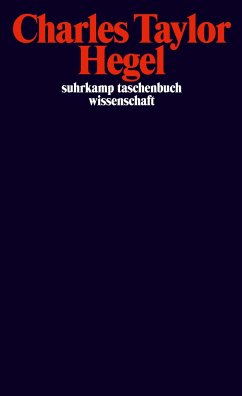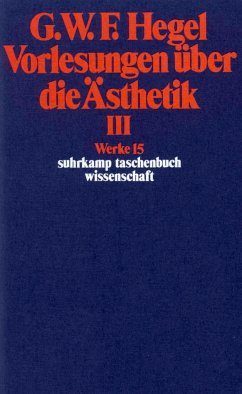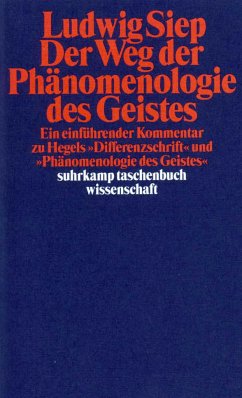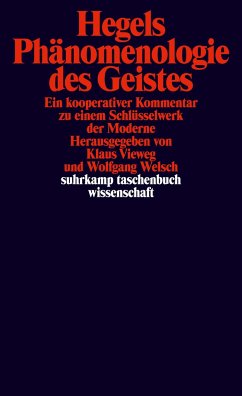verstellt den Kleinen heute leider den Blick darauf, daß man es - wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel - statt mit dem Hammer auch eher bohrend versuchen kann, als jemand, der seine Gedanken der Welt anzudrehen versteht wie eine Schraube, die eben noch locker war. Spekulatives Denken dieser Sorte sitzt nicht selten gerade deshalb, weil es zunächst andauernd im Kreis herumgeht, am Ende fester als das Behämmerte.
Daß man Hegel der Philosophiegeschichte und Doxographie überlassen soll, weil die holistisch sein ganzes System bestimmenden idealistischen Voraussetzungen seines Werks dessen Entstehungsepoche nicht überlebt haben, ist eine in Mitteleuropa verbreitete Ansicht. Sie dürfte so richtig sein wie die von Richard Rorty mit einschläfernder Regelmäßigkeit vorgebrachte Ansicht, die anglo-amerikanische analytische Philosophietradition des zwanzigsten Jahrhunderts sei tot; ihr Sterbedatum fällt hierbei bequemerweise immer auf den historischen Moment, da Rorty selbst sich von ihr abwandte. Das Drollige daran: Ausgerechnet der angeblich mausetote Hegel befruchtet neuerdings just die ebenso angeblich absterbende besagte anglo-amerikanische Tradition in bemerkenswerter Weise.
Man konnte das wohl ahnen, seit Donald Davidson seinen schönen Einfall, daß man Gedanken nicht alleine denken kann, sondern nur als jemand, der sich in einem sozialen Zusammenhang anderer Denkender weiß, bei Hegel wiederfand, während er die Transformation der analytischen Philosophie in eine sie dialektisch aufhebende "postanalytische" unternahm. Eine neue Anthologie ("Hegels Erbe". Herausgegeben von Christoph Halbig, Michael Quante und Ludwig Siep. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 434 S., br., 15,- [Euro]) zeigt insbesondere in den Beiträgen der analytisch gefärbten "Bostoner Neuhegelianer" Robert Brandom und John McDowell, daß mit Hegel immer noch ein Gestus der temperamentvollen Attacke auf lohnende Probleme verbunden sein kann - dessen Gewinn allerdings den Verlust des Geschichtsphilosophen Hegel, ja geradezu eine (mal offene, mal verdeckte) Entgeschichtlichung jenes Denkers mit sich bringt, den man von Adorno und Marcuse bis Fukuyama vor allem als radikalsten Historisten des neunzehnten Jahrhunderts gelesen hat.
Nicht nur als Galvanisator angelsächsischer Analytiker jedoch hat Hegel Gebrauchswert. Die kürzlich erfolgte Veröffentlichung einer die Schminke der geglätteten offiziellen Hegelschen "Ästhetik" auflösenden Vorlesungsmitschrift aus dem Sommersemester 1826 ("Philosophie der Kunst. Vorlesung von 1826". Herausgegeben von Annemarie Gethmann-Siefert, Jeong-Im Kwon und Karsten Berr. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 297 S., br., 10,- [Euro]) macht außerdem klar: Seine Kunstphilosophie ist eine der wenigen, die vor dem zwanzigsten Jahrhundert und seinen bis ins einundzwanzigste verschleppten Spukerscheinungen keine Angst haben müssen. Sie kann über alles mögliche Aufschluß geben, das Hegel selbst nicht gekannt hat: Der Gegensatz zwischen Romantik und Klassik etwa ist so, wie er ihn entwickelt hat, ziemlich genau der zwischen Punk-Rock und Heavy Metal respektive der zwischen Ostküsten- und Westküsten-Rap; seine Lehre davon, daß "so wie die wahrhafte Subjektivität anfängt, das Symbolische schwindet", beschreibt genau, wie der amerikanische Horrorfilm von den allegorischen Monsterepen der vierziger und fünfziger Jahre zu den antisymbolischen Viszeralschockern der sechziger und siebziger Jahre gelangen konnte; und wo er über Malerei und Zeichnung dozierend feststellt, die Formen der Darstellung von Gesichtsausdruck seien dem Ausdruck "nicht für sich angemessen": "Wenn die Kinder weinen, so verzerren ihre Gesichter sich so, daß wir darüber lachen", so gelangt er eine Seite später zu Überlegungen betreffs der Herstellung ausdrucksvoller Bildlichkeit, bei der "die Umrisse eine charakteristische Zeichnung mit wenig Strichen" verlangt, worin nicht weniger als die ganze Ausdruckstheorie der Comicfigur vorgebildet ist. Daß die popkulturinteressierte Jugend Hegels Überlegungen zur Ästhetik noch widerstehen kann, läßt sich demnach nur damit erklären, daß sie diese noch nicht kennt.
"Man möchte", hat der Dichter Ronald M. Schernikau stöhnen müssen, "daß, wer Hegel liest, ein anderer wird. Dann lernt man den Westherausgeber von Hegel kennen." Der deutscheste Bürgerphilosoph und bürgerlichste Deutsche wird im bürgerlichen Westen, anders als bei Sozialisten wie Schernikau oder Peter Hacks, immer noch viel zu selten gelesen - und sticht von der approbierten Einfallsausbeutung gegenwärtiger akademischer wie populärer Denkerei immer noch ab wie der erste richtige Daumen von der ersten echten Hand des ersten wirklichen Menschen.
DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
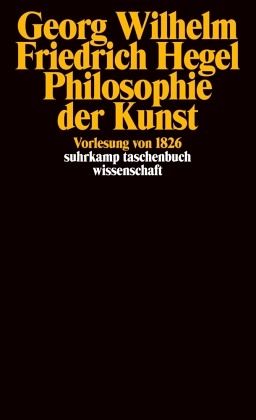





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2005