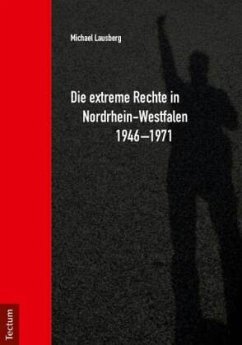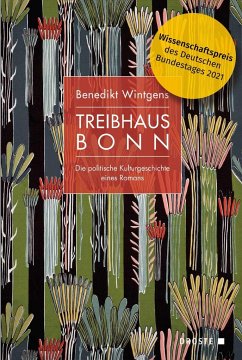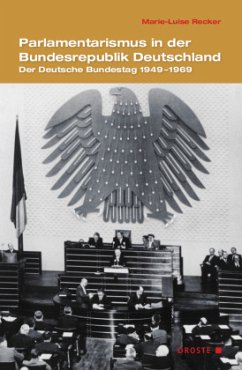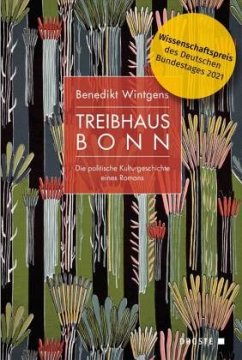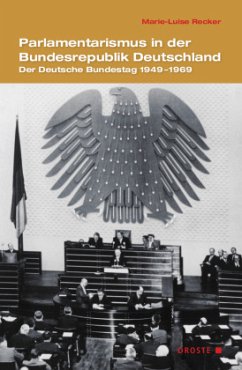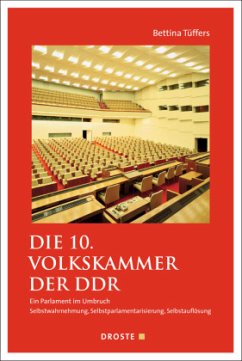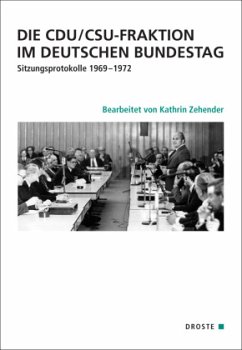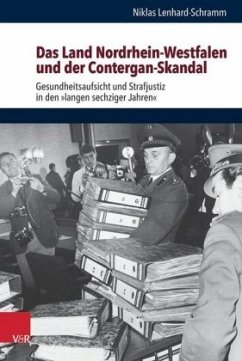nordrhein-westfälischen Parlamentarismus den Nachweis, dass die These vom unaufhaltsamen Niedergang des Länderparlamentarismus für Nordrhein-Westfalen falsch ist. Zumindest gilt dies für den untersuchten Zeitraum von 1946 bis 1980. Seit dem Erscheinen der bahnbrechenden Studie von Peter Hüttenberger über die Entstehung Nordrhein-Westfalens und seiner parlamentarischen Demokratie (1973) ist die Arbeit von Düding die erste umfassende Untersuchung des NRW-Parlamentarismus. Düding setzt mit dem Ende der achten Wahlperiode eine Zäsur, da 1980 eine neue politische Phase absoluter und später relativer sozialdemokratischer Dominanz beginnt und für die Zeit danach wegen der 30-jährigen Archivsperrfrist keine gleichwertige Quellenbasis verfügbar ist.
Die chronologisch aufgebaute Arbeit umfasst drei Analyseebenen: Erstens die durchgehende Untersuchung der Kräfteverhältnisse zwischen Regierung und parlamentarischer Opposition. Zweitens die punktuelle Verknüpfung der nordrhein-westfälischen Landes- mit der Bundespolitik und drittens die Fokussierung auf wichtige politische Persönlichkeiten. Einer dieser von Düding mit dem Begriff "Eliteparlamentarier" versehenen Politiker war Konrad Adenauer, der bis zu seinem Wechsel in die Bundespolitik eine herausragende Rolle im NRW-Parlament spielte und auch danach noch großen Einfluss auf die Geschicke des Landes ausübte. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten Karl Arnold, der zeit seines Lebens für eine enge Kooperation mit den Sozialdemokraten eintrat und große Koalitionen präferierte, setzte Adenauer schon früh auf eine bürgerliche Politik, in der für die SPD die Oppositionsrolle vorgesehen war.
Düding fügt der bekannten Rivalität zwischen Adenauer und Arnold einige interessante Facetten hinzu. Die Haltung des späteren Kanzlers entsprach durchaus nicht dem eher linken Zeitgeist der frühen Nachkriegsjahre. Dies galt ausdrücklich auch für die rheinisch-westfälische CDU, deren starker Sozialflügel der katholischen Soziallehre verhaftet war. Erkennbar wird dies in der Sozialisierungsdebatte des Landtags. Nur die FDP sprach sich konsequent gegen jede Form von Vergesellschaftung aus. NRW verstand sich seit Arnolds Zeiten als "soziales Gewissen" der Bundesrepublik. Nur in diesem Bundesland gab es bis 1950 eine Fünfparteienkonstellation, da die KPD im Arbeitermilieu des Ruhrgebiets und das Zentrum im katholischen Landmilieu traditionell fest verankert waren. Trotz der Parteienvielfalt war die parlamentarische Arbeit in der Frühphase von großer Sachlichkeit geprägt. Vorrangig ging es um die Linderung der täglichen Not, wobei der Kohleförderung eine Schlüsselrolle zukam. Der zählebige Mythos vom Ruhrkumpel wurde geboren, der erheblich dazu beitrug, dass in den Krisen der sechziger und siebziger Jahre dringend notwendige Strukturreformen durch kostspielige politische Förderprogramme verschleppt wurden. Zumeist geschah dies gegen den Willen der Bundesregierung.
Eine Quelle heftiger parlamentarischer Gefechte war immer wieder die Schul- und Bildungspolitik. Bei der Ausgestaltung der Landesverfassung kreiste der zentrale Disput um die Volksschule. Mit dem Segen vor allem der katholischen Kirche setzten CDU und Zentrum die Konfessions- gegen die von den anderen Parteien favorisierte christliche Gemeinschaftsschule durch. In den siebziger Jahren gab es Streit um die Gesamtschule, deren flächendeckende Einführung das Endziel sozialdemokratischer Bildungspolitik war. Ein von der CDU maßgeblich unterstütztes Volksbegehren setzte den unter dem Schlagwort "Chancengleichheit" firmierenden linken Schulreformen 1978 ein Ende. In diese Phase fiel auch der bildungseuphorische Aus- und Umbau der Hochschulen in NRW zur dichtesten Hochschullandschaft Europas.
In Zeiten von Pisa und Bologna vermittelt die Lektüre einige Déjà-vu-Erkenntnisse. Der Sturz Arnolds 1956 war das erste konstruktive Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik. Es folgten zwei Jahre sozial-liberaler Koalition. Im Zuge der Erhard-Agonie kam es 1966 in Düsseldorf zur zweiten sozial-liberalen Koalition, obwohl die Fortsetzung der bürgerlichen Koalition rechnerisch möglich gewesen wäre. Eine Blaupause für Bonn, wo es drei Jahre später mit tatkräftiger Hilfe der Düsseldorfer Parteifreunde zum Machtwechsel kam. Die sozial-liberale Koalition unter Ministerpräsident Kühn erwies sich trotz gelegentlicher Anfechtungen als sehr stabil. Der in den siebziger Jahren erstarkenden CDU gelang es nicht, auch in Düsseldorf eine Wende herbeizuführen. Kurz vor der Wahl von 1980 verstarb der aussichtsreiche CDU-Kandidat Heinrich Köppler an einem Herzinfarkt, wie Karl Arnold gut zwanzig Jahre zuvor. Da die FDP an der Fünfprozentklausel scheiterte, waren nur noch die beiden großen Parteien im Landtag vertreten. In der nun beginnenden Ära Rau wurde die SPD zur NRW-Partei.
Dem flüssig geschriebenen und trotz seines Umfangs gut lesbaren Buch zur Geschichte Nordrhein-Westfalens von seinen Anfängen bis in die achtziger Jahre wünscht man viele Leser.
URSULA ROMBECK-JASCHINSKI
Dieter Düding: Parlamentarismus in Nordrhein-Westfalen 1946-1980. Vom Fünfparteien- zum Zweiparteienlandtag. Droste Verlag, Düsseldorf 2008. 823 S., 88,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
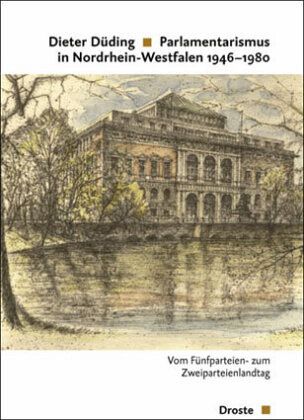




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.11.2009