Nicht lieferbar
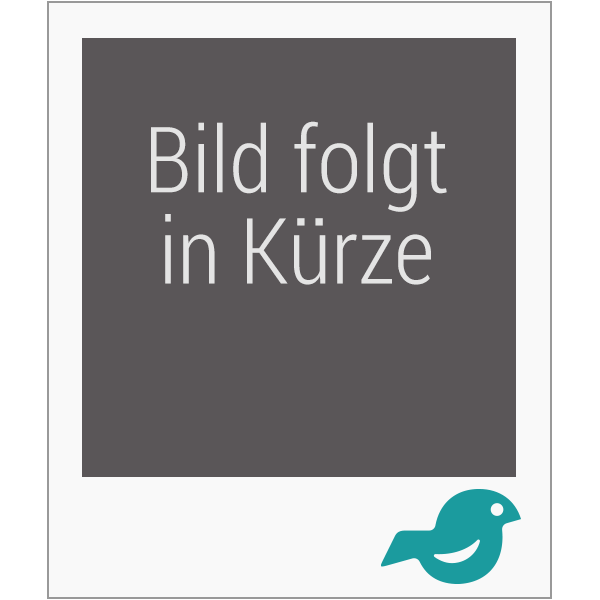
Pädagogik der frühen Kindheit im Kontext von Migration - Theoretische Grundlagen und erzieherische Praxis
Die Sicherung des Theorie-Praxis-Transfers dargelegt am Beispiel der kommunalen Kindertageseinrichtungen in München
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Seit geraumer Zeit sind die geringeren Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Das Postulat der Chancengleichheit ist Ausdruck einer Gesellschaft, die es sich bei kontinuierlichem Geburtenrückgang nicht leisten kann, Einzelne aufzugeben. Besondere Bedeutung kommt dabei der Pädagogik der frühen Kindheit zu, da hier die Basis für jeden weiteren Bildungsverlauf geschaffen wird.Die Autorin legt anhand einer Untersuchung von kommunaler Trägerschaft und Kindertageseinrichtungen in München die Möglichkeiten der Übertragung...
Seit geraumer Zeit sind die geringeren Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Das Postulat der Chancengleichheit ist Ausdruck einer Gesellschaft, die es sich bei kontinuierlichem Geburtenrückgang nicht leisten kann, Einzelne aufzugeben. Besondere Bedeutung kommt dabei der Pädagogik der frühen Kindheit zu, da hier die Basis für jeden weiteren Bildungsverlauf geschaffen wird.
Die Autorin legt anhand einer Untersuchung von kommunaler Trägerschaft und Kindertageseinrichtungen in München die Möglichkeiten der Übertragung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die erzieherische Praxis dar. Neben intensiver Personalentwicklung in den Kindertagesstätten ist dabei die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal ein Lösungsansatz.
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Einleitung
1. TEIL
1.1 Ausgangslage, Erkenntnisinteresse, Vorgehensweise, Forschungsgegenstand
1.2 Die Geschichte der Migration in der BRD - ein Rückblick
1.3 Die demographische Situation in Deutschland und in München
1.4 Die Rechtslage in Deutschland seit 2005
1.5 Gesellschaftspolitische und bildungspolitische Bezugsfelder der Pädagogik der frühen Kindheit im Hinblick auf Migrationsprozesse
1.6 Die Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen und die curriculare Entwicklung auf Länderebene und in Bayern
1.7 Entwicklungen der erzieherischen Praxis
1.8 Bildung und Erziehung im Elementarbereich von 1969 bis 2000 auf dem Hintergrund von Einwanderung
1.9 Die pädagogische Praxis der letzten Jahre am Beispiel einiger Bundesländer
1.10 Theoretische Grundlagen
1.11 Schlußfolgerungen
1.12 Die Hypothesen dieses Forschungsprojektes
1.12.1 Hypothese zur Verwaltungsebene und strukturellen Voraussetzungen
1.12.2 Hypothesen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung des Fachpersonals
1.12.3 Hypothesen zur pädagogischen Praxis in den Kindertageseinrichtungen
1.13 Methodische Vorgehensweise
2. TEIL
2.1 Elementarerziehung in München im Kontext von Bildungsauftrag und Migrationsprozessen
2.2 Geschichtliche Hintergründe und Entwicklungen der Elementarerziehung in München
2.3 Zur Situation der städtische Kindertageseinrichtungen in München heute
2.4 Exkurs - die Qualitätsinitiative in den Kindertageseinrichtungen in München
2.5 Schlußfolgerungen
3. TEIL
3.1 MIKE - Münchner interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich
3.2 Neue Trägerstruktur im Rahmen von NSM und QSE - der Aufbau und die Struktur der Fachberatung Interkulturelle Pädagogik
3.3 Der Begriff der Fachberatung - die Münchner Definition
3.4 Die Zielsetzung von MIKE
3.4.1 Der Ist-Stand vor MIKE im Januar 2002
3.4.2 Die Personalstruktur der Fachberatung
3.4.3 Das Beratungskonzept
3.4.4 Die Aufgabenstellungen der fachlichen Leitung/Koordination und der regionalen Fachberatungen
3.4.5 Die Beratungstätigkeit: Erhebungsdesign und Auswertung
3.4.6 Die Kooperation zwischen Fachberatung und Dienstund Fachaufsicht
3.5 Kritische Analyse
3.6 Personalentwicklung als Kernaufgabe von Fachberatung
3.6.1 Die interkulturellen Erzieherinnen in den Kitas
3.6.2 Aufgabe und Funktion der interkulturellen Erzieherinnen und Erzieher
3.6.3 Schlußfolgerungen - einige kritische Anmerkungen zur Stellenbesetzung der letzten Jahre
3.7 Beratungsschwerpunkte und fachliche Weiterqualifizierung des Personals im Rahmen von MIKE
3.7.1 Die Einarbeitung neuer interkultureller Erzieherinnen/Erzieher
3.7.2 Plenumsveranstaltungen und die Arbeitskreise der Regionalgruppen - Beratungspraxis in Form von Gremienarbeit
3.7.3 Reflexion der klassischen Beratung
3.7.4 Bedarfsdeckung und Personalentwicklung bei MIKE
3.7.5 IKE - flex: Stufenplan zur Regelung des Personaleinsatzes
3.7.6 Zielüberprüfung und Auswertung von ‚IKE-flex‘
3.8 Fortlaufende Qualifizierung des Fachpersonals durch Fortbildungen am pädagogischen Institut
3.8.1 Entwicklung eines Baukastensystems
3.8.2 Aufbau und Inhalte des Systems
3.8.3 Evaluation der Fortbildungsmaßnahmen
3.8.4 Analyse und Diskussion der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von MIKE
4. TEIL
4.1 Die pädagogischen Schwerpunkte - Sicherung des Paradigmenwechsels durch Projekte für die pädagogische Praxis
4.2 Die Struktur der Beratung durch Projekte für die Praxis
4.3 Praxisprojekte - eine Übersicht
4.4 Auswahl, Begründung und Vorgehensweise Projekte für die erzieherische Praxis
4.5 Projekte zur Kooperation mit Eltern in städtischen Kindertageseinrichtungen
4.5.1 Die Welt trifft sich am Eßtisch - Projektentwicklung, Implementierung, Durchführung, Evaluation und Analyse
4.5.1.1 Das Verpflegungssystem der Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt München
4.5.1.2 Interkulturelle Pädagogik, Kooperation mit Eltern, Ernährung und Religion
4.5.1.3 Entstehung des Projektes
4.5.1.4 Die Zusammensetzung der Projektgruppe
4.5.1.5 Ziele des Projektes
4.5.1.6 Der gemeinsame Weg
4.5.1.7 Die neu entwickelten Materialpakete der Tiefkühlkostanbieter
4.5.1.8 Kriterien der Auswahl der Kindertageseinrichtungen
4.5.1.9 Verteilung in den Kindertagseinrichtungen
4.5.1.10 Auswertung des Pilotprojektes
4.5.1.11 Der Interviewleitfaden
4.5.1.12 Die Durchführung der Interviews
4.5.1.13 Statistische Auswertung
4.5.1.14 Auswertung und Hypothesenüberprüfung
4.5.2 Kindergarten mal anders - Projektentwicklung, Implementierung, Durchführung, Evaluation und Analyse
4.5.2.1 Idee und Konzept
4.5.2.2 Pilotphase und Rahmenbedingungen
4.5.2.3 Ressourcennutzung und Multiplikation
4.5.2.4 Projektstandorte
4.5.2.5 Die Finanzierung
4.5.2.6 Einbettung in das neue Zuwanderungsgesetz
4.5.2.7 Das Projektteam
4.5.2.8 Die Befragung des Fachpersonals
4.5.2.8.1Der Interviewleitfaden und die Durchführung der Interviews
4.5.2.8.2Die statistische Auswertung
4.5.2.9 Die Befragung der Mütter
4.5.2.10 Analyse und Hypothesenüberprüfung
4.5.3 Projekte zur Kooperation mit Eltern in städtischen Kindertageseinrichtungen - Hypothesenüberprüfung
4.6 Deutsch als Zweitsprache - Exkurs in die theoretischen Grundlagen der Schwesterdisziplin
4.6.1. Relevante theoretische Ansätze und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
4.6.2 Frühkindliches Sprachwachstum und Mehrsprachigkeit
4.6.3 Zusammenfassung relevanter Aspekte aus der Forschung
4.7 Konsequenzen für die Methodik und Didaktik des Spracherwerbs im Elementarbereich
4.8 Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt München - eine Darstellung und kritische Diskussion der Rahmenkonzeption
4.9 Praxisprojekte zur Sprachförderung
4.9.1 'Sismik' - Beobachtung des Sprachzuwachses von Migrantenkindern im Kindergarten
4.9.1.1 Der Beobachtungsbogen selbst
4.9.1.2 Die Wahl des Instruments
4.9.1.3 Die Implementierungsschritte durch die Fachberatung
4.9.1.4 Die Zielsetzung der Untersuchung
4.9.1.5 Das Erhebungsdesign und der Umfang der Befragung
4.9.1.6 Die Statistische Auswertung
4.9.1.7 Schlußfolgerungen
4.9.2 'literacy' und mehrsprachige Erziehung - ein Projekt für die Praxis
4.9.2.1 Begriffsbestimmung
4.9.2.2 Das Pilotprojekt des Staatsinstituts für Frühpädagogik
4.9.2.3 Die Weiterentwicklung des Pilotprojektes in den Kindertageseinrichtungen der Stadt München
4.9.2.4 Die Zielsetzungen des Projektes
4.9.2.5 Die Multiplikation
4.9.2.6 Ergebnisse des ersten Untersuchungsteils - Wirkungsebene Fachpersonal
4.9.2.7 Zweiter Teil der Untersuchung - die Wirkungsebene der Kinder und ihre Sprachprogression
4.9.2.8 Analyse und kritische Stellungnahme
4.9.3 Hypothesenüberprüfung zu den Projekten zur Sprachförderung der Kinder
5. Teil Fazit und Empfehlungen
Literatur
Internetseiten
Verzeichnis benutzter Abkürzungen
Die Autorin legt anhand einer Untersuchung von kommunaler Trägerschaft und Kindertageseinrichtungen in München die Möglichkeiten der Übertragung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die erzieherische Praxis dar. Neben intensiver Personalentwicklung in den Kindertagesstätten ist dabei die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal ein Lösungsansatz.
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Einleitung
1. TEIL
1.1 Ausgangslage, Erkenntnisinteresse, Vorgehensweise, Forschungsgegenstand
1.2 Die Geschichte der Migration in der BRD - ein Rückblick
1.3 Die demographische Situation in Deutschland und in München
1.4 Die Rechtslage in Deutschland seit 2005
1.5 Gesellschaftspolitische und bildungspolitische Bezugsfelder der Pädagogik der frühen Kindheit im Hinblick auf Migrationsprozesse
1.6 Die Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen und die curriculare Entwicklung auf Länderebene und in Bayern
1.7 Entwicklungen der erzieherischen Praxis
1.8 Bildung und Erziehung im Elementarbereich von 1969 bis 2000 auf dem Hintergrund von Einwanderung
1.9 Die pädagogische Praxis der letzten Jahre am Beispiel einiger Bundesländer
1.10 Theoretische Grundlagen
1.11 Schlußfolgerungen
1.12 Die Hypothesen dieses Forschungsprojektes
1.12.1 Hypothese zur Verwaltungsebene und strukturellen Voraussetzungen
1.12.2 Hypothesen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung des Fachpersonals
1.12.3 Hypothesen zur pädagogischen Praxis in den Kindertageseinrichtungen
1.13 Methodische Vorgehensweise
2. TEIL
2.1 Elementarerziehung in München im Kontext von Bildungsauftrag und Migrationsprozessen
2.2 Geschichtliche Hintergründe und Entwicklungen der Elementarerziehung in München
2.3 Zur Situation der städtische Kindertageseinrichtungen in München heute
2.4 Exkurs - die Qualitätsinitiative in den Kindertageseinrichtungen in München
2.5 Schlußfolgerungen
3. TEIL
3.1 MIKE - Münchner interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich
3.2 Neue Trägerstruktur im Rahmen von NSM und QSE - der Aufbau und die Struktur der Fachberatung Interkulturelle Pädagogik
3.3 Der Begriff der Fachberatung - die Münchner Definition
3.4 Die Zielsetzung von MIKE
3.4.1 Der Ist-Stand vor MIKE im Januar 2002
3.4.2 Die Personalstruktur der Fachberatung
3.4.3 Das Beratungskonzept
3.4.4 Die Aufgabenstellungen der fachlichen Leitung/Koordination und der regionalen Fachberatungen
3.4.5 Die Beratungstätigkeit: Erhebungsdesign und Auswertung
3.4.6 Die Kooperation zwischen Fachberatung und Dienstund Fachaufsicht
3.5 Kritische Analyse
3.6 Personalentwicklung als Kernaufgabe von Fachberatung
3.6.1 Die interkulturellen Erzieherinnen in den Kitas
3.6.2 Aufgabe und Funktion der interkulturellen Erzieherinnen und Erzieher
3.6.3 Schlußfolgerungen - einige kritische Anmerkungen zur Stellenbesetzung der letzten Jahre
3.7 Beratungsschwerpunkte und fachliche Weiterqualifizierung des Personals im Rahmen von MIKE
3.7.1 Die Einarbeitung neuer interkultureller Erzieherinnen/Erzieher
3.7.2 Plenumsveranstaltungen und die Arbeitskreise der Regionalgruppen - Beratungspraxis in Form von Gremienarbeit
3.7.3 Reflexion der klassischen Beratung
3.7.4 Bedarfsdeckung und Personalentwicklung bei MIKE
3.7.5 IKE - flex: Stufenplan zur Regelung des Personaleinsatzes
3.7.6 Zielüberprüfung und Auswertung von ‚IKE-flex‘
3.8 Fortlaufende Qualifizierung des Fachpersonals durch Fortbildungen am pädagogischen Institut
3.8.1 Entwicklung eines Baukastensystems
3.8.2 Aufbau und Inhalte des Systems
3.8.3 Evaluation der Fortbildungsmaßnahmen
3.8.4 Analyse und Diskussion der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von MIKE
4. TEIL
4.1 Die pädagogischen Schwerpunkte - Sicherung des Paradigmenwechsels durch Projekte für die pädagogische Praxis
4.2 Die Struktur der Beratung durch Projekte für die Praxis
4.3 Praxisprojekte - eine Übersicht
4.4 Auswahl, Begründung und Vorgehensweise Projekte für die erzieherische Praxis
4.5 Projekte zur Kooperation mit Eltern in städtischen Kindertageseinrichtungen
4.5.1 Die Welt trifft sich am Eßtisch - Projektentwicklung, Implementierung, Durchführung, Evaluation und Analyse
4.5.1.1 Das Verpflegungssystem der Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt München
4.5.1.2 Interkulturelle Pädagogik, Kooperation mit Eltern, Ernährung und Religion
4.5.1.3 Entstehung des Projektes
4.5.1.4 Die Zusammensetzung der Projektgruppe
4.5.1.5 Ziele des Projektes
4.5.1.6 Der gemeinsame Weg
4.5.1.7 Die neu entwickelten Materialpakete der Tiefkühlkostanbieter
4.5.1.8 Kriterien der Auswahl der Kindertageseinrichtungen
4.5.1.9 Verteilung in den Kindertagseinrichtungen
4.5.1.10 Auswertung des Pilotprojektes
4.5.1.11 Der Interviewleitfaden
4.5.1.12 Die Durchführung der Interviews
4.5.1.13 Statistische Auswertung
4.5.1.14 Auswertung und Hypothesenüberprüfung
4.5.2 Kindergarten mal anders - Projektentwicklung, Implementierung, Durchführung, Evaluation und Analyse
4.5.2.1 Idee und Konzept
4.5.2.2 Pilotphase und Rahmenbedingungen
4.5.2.3 Ressourcennutzung und Multiplikation
4.5.2.4 Projektstandorte
4.5.2.5 Die Finanzierung
4.5.2.6 Einbettung in das neue Zuwanderungsgesetz
4.5.2.7 Das Projektteam
4.5.2.8 Die Befragung des Fachpersonals
4.5.2.8.1Der Interviewleitfaden und die Durchführung der Interviews
4.5.2.8.2Die statistische Auswertung
4.5.2.9 Die Befragung der Mütter
4.5.2.10 Analyse und Hypothesenüberprüfung
4.5.3 Projekte zur Kooperation mit Eltern in städtischen Kindertageseinrichtungen - Hypothesenüberprüfung
4.6 Deutsch als Zweitsprache - Exkurs in die theoretischen Grundlagen der Schwesterdisziplin
4.6.1. Relevante theoretische Ansätze und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
4.6.2 Frühkindliches Sprachwachstum und Mehrsprachigkeit
4.6.3 Zusammenfassung relevanter Aspekte aus der Forschung
4.7 Konsequenzen für die Methodik und Didaktik des Spracherwerbs im Elementarbereich
4.8 Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt München - eine Darstellung und kritische Diskussion der Rahmenkonzeption
4.9 Praxisprojekte zur Sprachförderung
4.9.1 'Sismik' - Beobachtung des Sprachzuwachses von Migrantenkindern im Kindergarten
4.9.1.1 Der Beobachtungsbogen selbst
4.9.1.2 Die Wahl des Instruments
4.9.1.3 Die Implementierungsschritte durch die Fachberatung
4.9.1.4 Die Zielsetzung der Untersuchung
4.9.1.5 Das Erhebungsdesign und der Umfang der Befragung
4.9.1.6 Die Statistische Auswertung
4.9.1.7 Schlußfolgerungen
4.9.2 'literacy' und mehrsprachige Erziehung - ein Projekt für die Praxis
4.9.2.1 Begriffsbestimmung
4.9.2.2 Das Pilotprojekt des Staatsinstituts für Frühpädagogik
4.9.2.3 Die Weiterentwicklung des Pilotprojektes in den Kindertageseinrichtungen der Stadt München
4.9.2.4 Die Zielsetzungen des Projektes
4.9.2.5 Die Multiplikation
4.9.2.6 Ergebnisse des ersten Untersuchungsteils - Wirkungsebene Fachpersonal
4.9.2.7 Zweiter Teil der Untersuchung - die Wirkungsebene der Kinder und ihre Sprachprogression
4.9.2.8 Analyse und kritische Stellungnahme
4.9.3 Hypothesenüberprüfung zu den Projekten zur Sprachförderung der Kinder
5. Teil Fazit und Empfehlungen
Literatur
Internetseiten
Verzeichnis benutzter Abkürzungen



