Denkgewohnheiten und Blickverengungen entwickelt hätten. Sie verhalten sich zueinander wie die Schopenhauerschen Stachelschweine, die wegen der Kälte zusammenrücken möchten, wegen der Stacheln aber Abstand halten müssen.
Die Soziologen neigen dazu, Subjektivität und individuelle Interessen für desintegrierend zu halten, also ausgeprägte Gemeinsamkeit als Voraussetzung der Zusammenarbeit, nicht etwa als deren Folge zu betrachten. Institutionen sollen deshalb das Handeln in die Richtung der kollektiven Ziele lenken. Die (vorherrschende neoklassische) Ökonomie scheint dagegen nur den eigennützigen isolierten Akteur zu kennen. Entsprechend haben die einen Mühe, das nichtkonforme Verhalten und die Veränderung in ihr System einzugliedern, während es den anderen schwerfällt, die Koordination zu erklären.
Die Gegensätzlichkeit dieser Denkstile spielt nicht nur in der Einleitung der Herausgeber, sondern auch in weiteren Beiträgen des Buches eine Rolle. Michaela Haase schildert, wie die neoklassische Trias von Nutzen, Rationalität und Gleichgewicht auch dazu geführt hat, daß Beziehungen zwischen Personen und Dingen, aber nicht von Person zu Person analysiert wurden, so daß die klassische Sicht des Marktes als einer sozialen Institution verlorengegangen ist. Hartmut Esser erinnert umgekehrt daran, daß das soziologische Verständnis der Institutionen in die Tradition der Versuche gehört, "reine" Moralprinzipien unabhängig vom individuellen Nutzen oder den vermuteten sozialen Folgen zu bestimmen, also der Logik des zweckrationalen Verhaltens ein eigenes nichtrationales, zum Beispiel "diskursethisches" Begründungssystem entgegenzustellen.
Freilich bleibt es nicht bei dieser spiegelbildlichen Darstellung der jeweiligen Ein-seitigkeiten, denn Johannes Berger und andere Autoren des Bandes zeigen, daß die Ökonomen sich in dieser Konkurrenz als lernfähiger erwiesen. Sie haben auf die Kritik sowohl mit intelligenter Strategie als auch mit wirklichen Korrekturen reagiert. Besonders der Nobelpreisträger Gary Becker und seine Schüler haben sich als virtuose Strategen einer aneignenden Auseinandersetzung erwiesen. Diese Technik einer Eingemeindung läuft darauf hinaus, entgegengesetzte Erklärungsprogramme als Variante des eigenen Ansatzes darzustellen, also hinter vordergründig irrationalen Verhaltensweisen doch noch verborgene Rationalität zu entdecken und jede Institution als einen Markt zu interpretieren. Schmerzhafter, aber nicht minder produktiv ist die Korrektur überlieferter Glaubenssätze. So ist die Annahme der Informiertheit zunächst durch die wiederbelebte Politische Ökonomie und dann durch Herbert Simon so gründlich erschüttert worden, daß nicht nur das Dogma der rationalen Wahl zu wanken begann. Das Problem der Informationsbeschaffung erinnerte auch daran, daß Markt und Tausch schon deshalb weder voraussetzungslos noch kostenlos sind, weil das Wissen und die sogenannten Daten nicht auf der Straße liegen.
Einsichten dieser Art haben dem Konzept der Transaktionskosten und damit auch der Neuen Institutionenökonomik den Weg gebahnt, die wiederum ihre Eingemeindungsstrategie betreibt: Die Menschen wählen demnach jeweils die Institutionen mit den geringsten Transaktionskosten. Dieser Ansatz erweitert zweifellos die Perspektive der neoklassischen Ökonomie, bleibt ihr aber so sehr verhaftet, daß er sich gegen jene evolutionären Erklärungen sperrt, die mit der Einsicht beginnen, daß Institutionen meist nicht aus rationaler Wahl entstehen, sondern daß sie bloß "Ergebnisse menschlichen Handelns, nicht menschlichen Plans" sind.
Diese Institutionenökonomik teilt jedenfalls mit der klassischen Vertragstheorie die Verlegenheit, den Betroffenen unterstellen zu müssen, sie hätten sich für eine bestimmte Ordnung bewußt entschieden. In die Richtung evolutionärer Erklärungen und damit auch einer möglichen Annäherung der soziologischen und der ökonomischen Denkweise deuten jedoch gerade die anwendungsorientierten Beiträge in dem Sammelband. Ob Dirk Ipsen und Niels Peter Thomas das Instrumentarium der Transaktionskostenökonomik auf Unternehmensformen anwenden oder ob Walter Müller-Gentsch, Britta Rehder und Stephan Lessenich in drei verschiedenen Aufsätzen den Wandel der Arbeitsbeziehungen erörtern (wobei auf Schumpeters Spuren zwischen "Anpassungsreaktionen" und "kreativer Zerstörung" von Regeln unterschieden wird), immer zeigt sich, wie sehr die organisatorische und die ordnungspolitische Phantasie auf theoretische Impulse angewiesen sind.
Zwei Beiträge zur Rolle des Geldes demonstrieren schließlich noch einmal die Unterschiedlichkeit der Institutionenkonzepte. Christoph Deutschmann schließt sich der soziologisch-funktionalistischen Deutung an: Institutionen seien durch ihre die "Unsicherheit reduzierenden Funktionen" definiert. Geld stehe jedoch "jenseits der Institutionen, denn es reduziert Unsicherheit nicht, sondern erzeugt sie erst". Peter Spahn dagegen schildert Geld als Institution der Marktökonomie, die abstrakte entpersönlichte und mehrseitige Beziehungen an die Stelle des direkten Verhältnisses von Gläubigern und Schuldnern setzt, also die Zusammenarbeit von den Bedingungen der Vertrautheit und des Vertrauens löst.
Auch dieser Sammelband ist nicht frei von den Problemen seiner Gattung. Manche Beiträge stehen zu dem Thema in einem eher mittelbaren Zusammenhang, ihre Anordnung führt den Gedankengang nicht immer auf geradem Weg voran. Doch lohnt sich in diesem Fall die Mühe, weil der rote Faden vorhanden ist. Der Band erlaubt in einer aufschlußreichen Weise den Vergleich der Erkenntnisprogramme der Soziologie und der Ökonomie. Und - ob man ökumenische Hoffnungen pflegen soll und will oder nicht - der Leser erfährt, warum diese beiden Sozialwissenschaften bislang nicht zu einer gemeinsamen Theorie des sozialen Handelns gefunden haben.
MICHAEL ZÖLLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
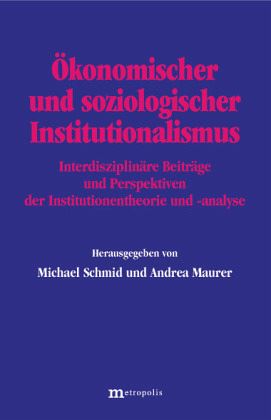




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.07.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.07.2004