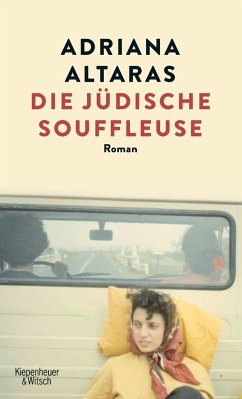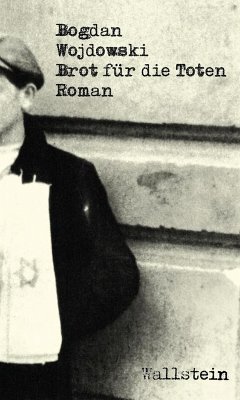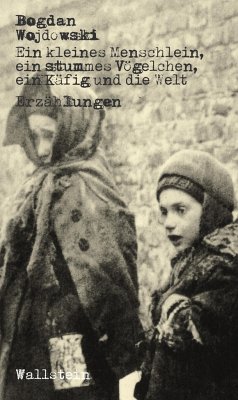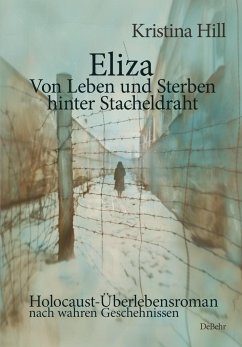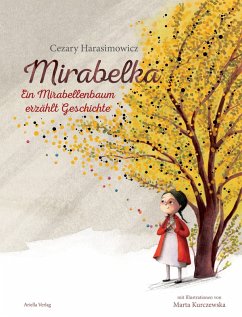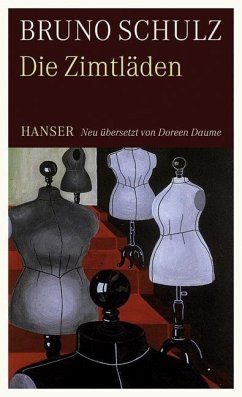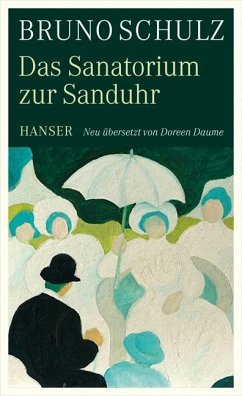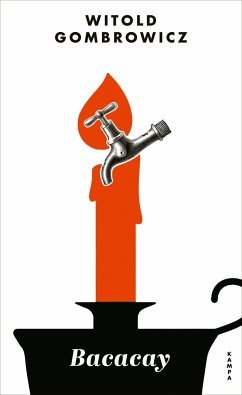Juden.
In "Nowolipie", das er seinen Enkelkindern Ewa und Tomek widmet, erzählt Hen die Geschichte der ersten sechzehn Jahre seines Lebens, von den frühesten behaltenen Bildern bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Er versucht also, den beiden - und gleichzeitig uns, Lesern - ein möglichst genaues Bild seiner selbst von damals zu vermitteln: eines Jungen, der inmitten des jüdischen Viertels in einer mehrköpfigen Familie aufwuchs. Der Vater besaß eine kleine Firma für Sanitärinstallationen, die Mutter kümmerte sich um die vier Kinder, und alle zusammen lebten sie in einem mehrstöckigen Mietshaus mit vielen Nachbarn und einem gemeinsamen Hof - dem Spieleldorado der Kinder -, der für den kleinen Józef aber nur kurz der einzige "Sozialisierungsort" blieb. Schon mit vier Jahren wurde er in den Kindergarten geschickt, dann folgte seine Wanderung durch mehrere Schulen, und im Alter von knapp neun Jahren wurde er Mitarbeiter der von Janusz Korczak begründeten "Kleinen Rundschau", was er allerdings damals nicht als wegweisend empfand: "Ich hielt mich nicht für ein Wunderkind, und ich war auch keins. Nur mühsam fand ich etwas Beschreibenswertes."
Viel mehr interessierten ihn Sport, vor allem Fußball, in dem er Beachtliches leistete, Spiele, Abenteuer, später Kinobesuche und erste Mädchenbekanntschaften, die er teils in Warschau, teils in Michalin und Swider erlebte. Die beiden Orte, wo seine Familie die Sommerferien, zunächst in einer eigenen Villa, dann in der einen oder anderen Pension, verbrachte, lagen an der sogenannten Otwock-Linie, einem Abschnitt der Bahnstrecke zwischen Warschau und Lublin. Es war eine Gegend voller Kiefernwälder, in die man schon im neunzehnten Jahrhundert zur Kur fuhr, hauptsächlich um Tuberkulose und Geisteskrankheiten behandeln zu lassen; erst später wurde die Gegend zu einem beliebten Urlaubsziel, wobei die meisten Gäste dort Juden waren.
Nicht zufällig fungiert aber als Titel des Buchs der Name jener Straße, in der Hen aufgewachsen ist - genauso detailliert wie seine eigene erzählt er auch deren Geschichte: mit den Nachbarn und Verwandten, den Schulfreunden und Spielkameraden, den Lehrern, Handwerkern und Geschäftsleuten, den Kinderfrauen und Dienstmädchen, die alle in diesem Mikrokosmos ihren festen Platz haben. So zeigt er anhand unzähliger Episoden, wie der Alltag der jüdischen Bewohner Warschaus aussah, wie wir uns Dinge wie innerfamiliären Umgang, Erziehung der Kinder, Atmosphäre einer Schule, Arbeitsalltag der Erwachsenen, medizinische Versorgung, tägliche Rituale, Feiertagsbräuche et cetera vorzustellen haben. Und wie dieser Alltag sich im Laufe der Jahre veränderte, von einfachen Komfortverbesserungen wie fließendes Wasser über gesellschaftliche Phänomene, etwa die Säkularisierung einzelner Familien oder die sprachliche Assimilation eines bedeutenden Teils der Intelligenz, bis hin zur politischen Radikalisierung der jungen Generation.
Es gibt aber etwas, was dieses insgesamt sehr harmonische Bild des Viertels konsequent stört: Das Buch endet im Herbst 1939; bald werden sich in diesen Straßen, Nowolipie, Mila, Krochmalna oder Leszno, grauenvolle Szenen abspielen, und sie selbst werden plötzlich alle zu einem einzigen Ort mit dem nüchternen Namen "Umschlagplatz" führen. Doch Hen, der diese spätere Zeit vollkommen ausklammert, knüpft trotzdem ständig an sie an, indem er immer wieder das weitere Schicksal seiner Protagonisten zu erraten versucht. Diese Versuche enden aber in den meisten Fällen mit der gleichen Feststellung: "Ich weiß nicht, was für ein Schicksal der Herr Krelman hatte." Oder: "Ich weiß nicht, wer von ihnen überlebt hat." Diese leitmotivisch wiederkehrenden lakonischen Sätze sind umso eindrucksvoller, als sie kein einziges Mal mit einer Beschreibung von Tod, Leiden und Trauma einhergehen und gleichzeitig immer wieder ganz unvermittelt inmitten des nostalgischen Festhaltens verblassender Bilder und verhallender Stimmen daherkommen. Sie machen das Buch bei allem Charme zu einem Klagelied über, wie Hen es formuliert, "ganz normale, meist in der europäischen Tradition verwurzelte Leute, die zufällig Juden waren und deshalb ermordet wurden".
Er selbst hat den Holocaust nicht erleben müssen, jedenfalls nicht direkt. Dafür verlor er durch ihn mehrere Familienmitglieder: seinen Vater, der 1945 in Buchenwald ermordet wurde, einen in der Sowjetunion verschollenen Bruder und eine Schwester, die 1942 ums Leben kam. Nur seine Mutter und eine weitere Schwester überlebten, und dass er selbst den Nazis entkommen konnte, lag nur daran, dass er im Spätherbst 1939 in das von den Sowjets besetzte Lemberg und in dessen Umgebung, von dort dann weiter nach Samarkand in Usbekistan flüchtete, wo er 1941 in die Rote Armee und drei Jahre später in die polnische Volksarmee eingezogen wurde. Diesen Teil seiner Jugend beschreibt er jedoch erst im zweiten Teil seiner Erinnerungen, die den ironischen Titel "Die schönsten Jahre" tragen und von denen es leider bislang keine deutsche Fassung gibt.
Heute erscheinen in Polen beide Teile meist zusammen, wobei "Nowolipie", das von Hen im April 1990 fertiggestellt wurde und ein Jahr später herauskam, von Anfang an stärkere Resonanz fand. Solche autobiographischen Berichte waren bis dahin in der polnischen Literatur nur selten zu finden, denn das kommunistische Regime schrieb den Schriftstellern eine optimistische Weltsicht vor, zu der auch eine indirekte Erinnerung an den Holocaust wenig passte, und fand das Thema umso heikler, als es auch nach dem Krieg genug Ereignisse gab, die für die polnischen Juden schmerzvoll waren. Etwa das berüchtigte Pogrom in Kielce (1946) oder die antisemitische Hetzkampagne von 1968/69, die einen Massenexodus der polnischen Juden auslöste.
Auch Hen verließ damals das Land, doch es war nur eine seiner üblichen Paris-Eskapaden - nach einem halben Jahr war er wieder in Warschau. Er konnte offenbar ohne diese Stadt nicht leben, und wenn man seine Kindheitserinnerungen liest, hat man das Gefühl, dass er nicht nur Warschau, sondern gar das einstige Judenviertel niemals verlassen habe. Er beschreibt es mit solcher Intensität und Präzision, mit so viel Wärme, Empathie und Humor, dass man trotz der Schlusssätze ("Ich bin nie mehr in die Nowolipie zurückgekehrt. Sah nicht mit an, wie meine Straße starb") glaubt, er wäre dort immer noch zu Hause. MARTA KIJOWSKA
Józef Hen: "Nowolipie - Meine jüdische Straße".
Aus dem Polnischen von Roswitha Matwin-Buschmann. Arco Verlag, Wuppertal 2024. 363 S., br., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.
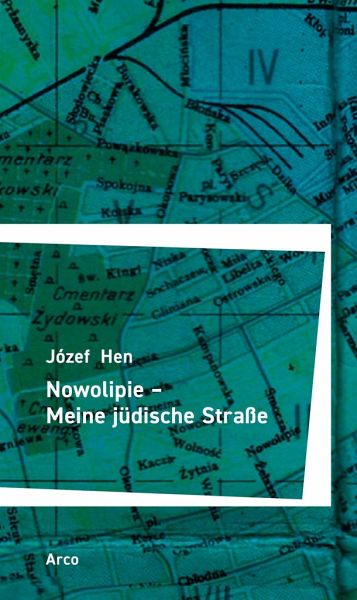




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2024
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.06.2024