Nicht lieferbar
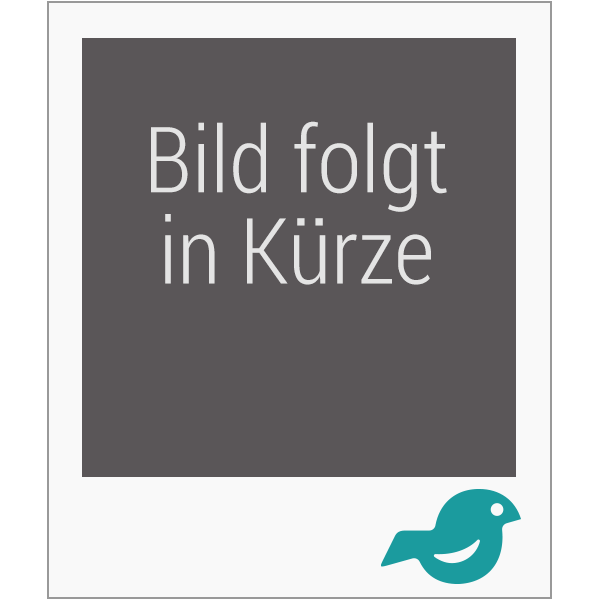
Norwegen
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Auszug aus der Reportage "Sport ohne Grenzen" von Peter Linden:
Lars ist der König im Ameisenhaufen. Und wir, die Ameisen, folgen ihm sklavisch ergeben. Wenn Lars sich durch enge Spalten quetscht, quetschen wir uns auch. Balanciert er über einen kühnen Grat, tasten sich unsere Füße ebenfalls darüber. Stürzt er sich voller Begeisterung einen Abhang hinunter, stolpern wir irgendwie hinterher. Kriecht er schließlich, auf allen vieren, ins Innere seines Reiches, legen wir uns auf den Bauch und rutschen zaghaft dem Ungewissen entgegen. Manchmal kommt Beklemmung auf, doch Widerrede wäre zwecklos: Wir, gut 20 Touristen aus aller Welt, hängen alle an einem Seil. Der Ameisenhaufen, in den uns Lars gelockt hat, besitzt nur einen Ausgang. Und den kennt König Lars.
Andere ziehen andere Vergleiche für diese Gletscherlandschaft im Nationalpark Jotunheimen. Tracey, eine Neuseeländerin aus London, wähnt sich in einem Labyrinth aus Sanddünen, vermutlich, weil sie ein bisschen friert in ihrer dünnen Regenjacke. Stephan, ein Münchner aus Hannover, denkt an Emmentaler, wahrscheinlich hat er Hunger. Später fällt Stephan noch Eiscreme ein. Eine witzige Vorstellung: Millionen Kubikmeter Eiscreme und wir mittendrin. berhaupt treibt dieser dreidimensionale Spazierweg durch glattes, raues, weiches, hartes, spitzes, rundes Gelände die Fantasie zu wilden Kapriolen: Soeben fängt Tracey an, Lars' Ameisenhaufen zu möblieren. Mit mächtigen Lüstern an den Decken und gigantischen Schränken aus Glas.
In den Wänden gluckert es, plätschert, stöhnt es und ächzt. Die Gewölbe funkeln weiß, blau, türkis, aquamarin. Im Untergeschoss glitzert ein Pool, noch tiefer rauschen die Wasser durch mächtige Rohre. Das Seil, an dem wir hängen, spannt wieder. Eine Art Wendeltreppe führt nach oben, Lars klettert als erster. Wir drehen uns wie ein Korkenzieher hinterher. Und auf einmal stehen wir am Ausgangspunkt unseres Ausflugs, auf einer Felskanzel im Nationalpark Jotunheimen. Drei Stunden sind wir den verschlungenen Pfaden von Lars gefolgt. Drei Stunden haben wir im Innern von Norwegens aufregendstem Eis verbracht: dem Svellnosbreen (Breen bedeutet auf Norwegisch Gletscher).
"Vor drei Tagen", erzählt Lars, als wir unten auf der Alm Spiterstulen vor dem Kamin sitzen, sei ein Mann samt Hund in eine Gletscherspalte gefallen: "Dann haben wir beide wieder herausgezogen." Ein anderer sei auf einmal wie eine Statue erstarrt, vor Angst. Lars hat ihn aufgetaut mit einigen Brocken Englisch und Lächeln. Für Lars ist der Gletscher Abenteuerspielplatz, Märchenreich und Arbeitsplatz zugleich. Täglich muss er seine Touren variieren. Denn der Svellnosbreen ruht nicht. Er spaltet sich, donnert unten an der Kante stückweise in den Fluss, der aus seinem Innern sprudelt. "Nichts in Norwegen ist spannender als der Gletscher", sagt Lars.
Mehr noch: Norwegen, das sind die Gletscher. Und Jotunheimen, der 1980 gegründete Nationalpark auf halbem Weg zwischen Bergen und Oslo, zeigt die beeindruckendsten Seiten des Königreichs: 200 in Eis erstarrte Quadratkilometer, 70 mehr als in den gesamten Alpen. Die höchsten Gipfel, der höchste Wasserfall des Landes. Karge Almen und liebliche Täler. Der schönste See, die schwierigsten Kletterfelsen, gewaltige Höhlensysteme. Ein Sommerskigebiet und schäumende Flüsse für Rafter. Einsame Wildnis und Peer Gynts populärer Besseggengrat. Er ist nur einer von 19 Nationalparks Norwegens, aber was für einer! Esben Boe, der Parkmanager, wacht von seinem Büro in Lom aus über eine Fläche, halb so groß wie das Saarland.
Die meisten der Parkbesucher, berichtet Boe, kämen, um den Galdhoepiggen zu besiegen. Seit die Eiskappe auf dem benachbarten Glittertind um gut 15 Meter abgeschmolzen ist, gilt der 2469 Meter hohe Felsklotz oberhalb des Svellnosbreen als Norwegens höchster Gipfel. Und Spiterstulen, einst einfache Alm, heute Superalm ohne Vieh mit umso mehr Betten, gilt Norwegens Bergsteigern als Luxusbasislager für eintägige Expeditionen. 1844 kam als Erster ein gewisser Professor Keilhau mit zwei Studenten vorbei und wurde herzlich aufgenommen. Ab 1860 sahen sich die Bergbauern genötigt, ihren Gästen ein paar Kronen für Kost und Logis zu berechnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Straße, der Strom, das Fernsehen und der Wandel zum Berghotel.
Um zehn Uhr morgens stehen wir bereit, auch Tracey, Stephan und viele andere haben es auf die 2469 Meter abgesehen. Tracey beginnt nach dem ersten Steilhang einer philosophischen Grundfrage nachzugehen: "Why do I do that", warum tu ich das nur? Christina, Schülerin aus Bergen, weiß es schon: "Das hat noch keiner in meiner Familie geschafft." Tapfer schleppt sie ihren provisorischen Rucksack, einen gelben Plastikbeutel, in dem sie sonst ihr Zelt verstaut.
Auf 1400 Metern: das erste Schneefeld. Für Wanderer mit Gummistiefeln und Sandalen heißt es nun: zwei Schritte vorwärts, eineinhalb zurück. Die Turnschuhe saugen sich voll und beginnen zu quietschen. Stephan, perfekt ausgerüstet und ohnehin flott unterwegs, zieht eine weitere Trumpfkarte: Skistöcke. Drei Schritte vorwärts, keiner zurück. Aus Traceys Perspektive wird Stephan immer kleiner. Sie fragt: "Why do I do that?" Aber umkehren? Die Sonne brennt, kein Wind, keine Wolken. Und alle, alle steigen, gehen, schleppen sich weiter. Eiliv, der alte Hüttenwirt von Spiterstulen, war schon mehr als 100-mal oben.
Auf 2369 Metern: die Stelle, an der manche schier verzweifeln. Der Gipfel ist gar nicht der Gipfel und heißt Keilhaustopp. Steht man da oben, geht es wieder ein Stück abwärts und wieder hinauf und später noch einmal, was noch keiner ahnt. Wanderkarten enthüllen: Der Galdhoepiggen liegt weiter westlich. Die Sandalen stöhnen, die Turnschuhe quietschen immer noch, Stephan liegt, die Gletscherbrille im Gesicht, auf einer Terrasse aus Schieferplatten, verschlingt einen Müsliriegel und nimmt einen Schluck Energie aus der Dose. Als Tracey schwitzend und keuchend ankommt, trifft sie fast der Schlag. Noch eine ganze Stunde bis zum Gipfel. "Why do I do that?"
Auf 2469 Metern: alles vergessen. Besoffene Blicke kreuzen schwarze Wände, schweifen über gleißende Eisfelder, drehen ab zum dunkelblauen Himmel, tasten am Horizont die Kante des riesigen Jostedalsbreen ab. Stephan hat sich ein Lager aus seiner Goretexjacke gebaut, Tracey sitzt auf einem unbequemen Felsblock und nippt an einer Tasse Tee, die sie im steinernen Gipfelhaus gekauft hat. Seit 1925 thront die "Steinarstugu" auf dem Galdhoepiggen, ihre hölzerne Vorgängerin hatte ein Winterorkan weggefegt. Um 14 Uhr taucht plötzlich Lars auf, der seine Gruppe über den Svellnosbreen zum Gipfel geführt hat. ...
Lars ist der König im Ameisenhaufen. Und wir, die Ameisen, folgen ihm sklavisch ergeben. Wenn Lars sich durch enge Spalten quetscht, quetschen wir uns auch. Balanciert er über einen kühnen Grat, tasten sich unsere Füße ebenfalls darüber. Stürzt er sich voller Begeisterung einen Abhang hinunter, stolpern wir irgendwie hinterher. Kriecht er schließlich, auf allen vieren, ins Innere seines Reiches, legen wir uns auf den Bauch und rutschen zaghaft dem Ungewissen entgegen. Manchmal kommt Beklemmung auf, doch Widerrede wäre zwecklos: Wir, gut 20 Touristen aus aller Welt, hängen alle an einem Seil. Der Ameisenhaufen, in den uns Lars gelockt hat, besitzt nur einen Ausgang. Und den kennt König Lars.
Andere ziehen andere Vergleiche für diese Gletscherlandschaft im Nationalpark Jotunheimen. Tracey, eine Neuseeländerin aus London, wähnt sich in einem Labyrinth aus Sanddünen, vermutlich, weil sie ein bisschen friert in ihrer dünnen Regenjacke. Stephan, ein Münchner aus Hannover, denkt an Emmentaler, wahrscheinlich hat er Hunger. Später fällt Stephan noch Eiscreme ein. Eine witzige Vorstellung: Millionen Kubikmeter Eiscreme und wir mittendrin. berhaupt treibt dieser dreidimensionale Spazierweg durch glattes, raues, weiches, hartes, spitzes, rundes Gelände die Fantasie zu wilden Kapriolen: Soeben fängt Tracey an, Lars' Ameisenhaufen zu möblieren. Mit mächtigen Lüstern an den Decken und gigantischen Schränken aus Glas.
In den Wänden gluckert es, plätschert, stöhnt es und ächzt. Die Gewölbe funkeln weiß, blau, türkis, aquamarin. Im Untergeschoss glitzert ein Pool, noch tiefer rauschen die Wasser durch mächtige Rohre. Das Seil, an dem wir hängen, spannt wieder. Eine Art Wendeltreppe führt nach oben, Lars klettert als erster. Wir drehen uns wie ein Korkenzieher hinterher. Und auf einmal stehen wir am Ausgangspunkt unseres Ausflugs, auf einer Felskanzel im Nationalpark Jotunheimen. Drei Stunden sind wir den verschlungenen Pfaden von Lars gefolgt. Drei Stunden haben wir im Innern von Norwegens aufregendstem Eis verbracht: dem Svellnosbreen (Breen bedeutet auf Norwegisch Gletscher).
"Vor drei Tagen", erzählt Lars, als wir unten auf der Alm Spiterstulen vor dem Kamin sitzen, sei ein Mann samt Hund in eine Gletscherspalte gefallen: "Dann haben wir beide wieder herausgezogen." Ein anderer sei auf einmal wie eine Statue erstarrt, vor Angst. Lars hat ihn aufgetaut mit einigen Brocken Englisch und Lächeln. Für Lars ist der Gletscher Abenteuerspielplatz, Märchenreich und Arbeitsplatz zugleich. Täglich muss er seine Touren variieren. Denn der Svellnosbreen ruht nicht. Er spaltet sich, donnert unten an der Kante stückweise in den Fluss, der aus seinem Innern sprudelt. "Nichts in Norwegen ist spannender als der Gletscher", sagt Lars.
Mehr noch: Norwegen, das sind die Gletscher. Und Jotunheimen, der 1980 gegründete Nationalpark auf halbem Weg zwischen Bergen und Oslo, zeigt die beeindruckendsten Seiten des Königreichs: 200 in Eis erstarrte Quadratkilometer, 70 mehr als in den gesamten Alpen. Die höchsten Gipfel, der höchste Wasserfall des Landes. Karge Almen und liebliche Täler. Der schönste See, die schwierigsten Kletterfelsen, gewaltige Höhlensysteme. Ein Sommerskigebiet und schäumende Flüsse für Rafter. Einsame Wildnis und Peer Gynts populärer Besseggengrat. Er ist nur einer von 19 Nationalparks Norwegens, aber was für einer! Esben Boe, der Parkmanager, wacht von seinem Büro in Lom aus über eine Fläche, halb so groß wie das Saarland.
Die meisten der Parkbesucher, berichtet Boe, kämen, um den Galdhoepiggen zu besiegen. Seit die Eiskappe auf dem benachbarten Glittertind um gut 15 Meter abgeschmolzen ist, gilt der 2469 Meter hohe Felsklotz oberhalb des Svellnosbreen als Norwegens höchster Gipfel. Und Spiterstulen, einst einfache Alm, heute Superalm ohne Vieh mit umso mehr Betten, gilt Norwegens Bergsteigern als Luxusbasislager für eintägige Expeditionen. 1844 kam als Erster ein gewisser Professor Keilhau mit zwei Studenten vorbei und wurde herzlich aufgenommen. Ab 1860 sahen sich die Bergbauern genötigt, ihren Gästen ein paar Kronen für Kost und Logis zu berechnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Straße, der Strom, das Fernsehen und der Wandel zum Berghotel.
Um zehn Uhr morgens stehen wir bereit, auch Tracey, Stephan und viele andere haben es auf die 2469 Meter abgesehen. Tracey beginnt nach dem ersten Steilhang einer philosophischen Grundfrage nachzugehen: "Why do I do that", warum tu ich das nur? Christina, Schülerin aus Bergen, weiß es schon: "Das hat noch keiner in meiner Familie geschafft." Tapfer schleppt sie ihren provisorischen Rucksack, einen gelben Plastikbeutel, in dem sie sonst ihr Zelt verstaut.
Auf 1400 Metern: das erste Schneefeld. Für Wanderer mit Gummistiefeln und Sandalen heißt es nun: zwei Schritte vorwärts, eineinhalb zurück. Die Turnschuhe saugen sich voll und beginnen zu quietschen. Stephan, perfekt ausgerüstet und ohnehin flott unterwegs, zieht eine weitere Trumpfkarte: Skistöcke. Drei Schritte vorwärts, keiner zurück. Aus Traceys Perspektive wird Stephan immer kleiner. Sie fragt: "Why do I do that?" Aber umkehren? Die Sonne brennt, kein Wind, keine Wolken. Und alle, alle steigen, gehen, schleppen sich weiter. Eiliv, der alte Hüttenwirt von Spiterstulen, war schon mehr als 100-mal oben.
Auf 2369 Metern: die Stelle, an der manche schier verzweifeln. Der Gipfel ist gar nicht der Gipfel und heißt Keilhaustopp. Steht man da oben, geht es wieder ein Stück abwärts und wieder hinauf und später noch einmal, was noch keiner ahnt. Wanderkarten enthüllen: Der Galdhoepiggen liegt weiter westlich. Die Sandalen stöhnen, die Turnschuhe quietschen immer noch, Stephan liegt, die Gletscherbrille im Gesicht, auf einer Terrasse aus Schieferplatten, verschlingt einen Müsliriegel und nimmt einen Schluck Energie aus der Dose. Als Tracey schwitzend und keuchend ankommt, trifft sie fast der Schlag. Noch eine ganze Stunde bis zum Gipfel. "Why do I do that?"
Auf 2469 Metern: alles vergessen. Besoffene Blicke kreuzen schwarze Wände, schweifen über gleißende Eisfelder, drehen ab zum dunkelblauen Himmel, tasten am Horizont die Kante des riesigen Jostedalsbreen ab. Stephan hat sich ein Lager aus seiner Goretexjacke gebaut, Tracey sitzt auf einem unbequemen Felsblock und nippt an einer Tasse Tee, die sie im steinernen Gipfelhaus gekauft hat. Seit 1925 thront die "Steinarstugu" auf dem Galdhoepiggen, ihre hölzerne Vorgängerin hatte ein Winterorkan weggefegt. Um 14 Uhr taucht plötzlich Lars auf, der seine Gruppe über den Svellnosbreen zum Gipfel geführt hat. ...



