auch zu unserer alltäglichen Verdrängung. Günter Amendt meint es dabei gar nicht affirmativ, sondern ganz resigniert realistisch, wenn er schon mit dem Titel seines Buches eine drogenfreie Zukunft für unmöglich erklärt.
Der verdiente Sexualaufklärer der 68er-Generation und Chronist der Popkultur bleibt den linken Diagnosen treu: "Die Verhältnisse sind krankmachend." Aber in kaum einem anderen Segment der Wirklichkeit ist diese Binsenweisheit ähnlich berechtigt wie bei der Drogenpolitik, die der Autor mit Verve aufs Korn nimmt. Warum verdient die Pharmaindustrie Milliarden an verschreibungspflichtigen Drogen wie chemischen Happypills, Antidepressiva oder Wachmachern, während der harmlose Anbau von Hanfpflanzen im eigenen Garten immer noch strafbar ist? Wieso die gesellschaftliche Hexenjagd auf Kokainkonsumenten - ob es sich nun um einen Fußballtrainer, einen Fernsehmoderator oder wie dieser Tage den über achtzigjährigen Ehrensenator Italiens und katholischen Spitzenfunktionär handelt?
Die Krankheit, als welche die Droge im öffentlichen Bild erscheint, ist laut Amendt eher die Verfassung unserer Gesellschaft. Und die läßt meist die prominenten Drogenopfer ungeschoren davonkommen und bringt die ärmeren, weniger privilegierten ins Gefängnis. Als Leistungsgesellschaft zwingt sie die Menschen, alles aus sich herauszuholen, was sie oft nur noch mit Hilfe von Drogen bewerkstelligen. Als Angstgesellschaft verbaut sie nicht nur Jüngeren mit Krieg und Zukunftsvernichtung den Lebensmut und lädt zur Weltflucht geradezu ein. Als Risikogesellschaft fordert sie Gefahrentoleranz - ein Rasierklingentanz, der oft nur mit Drogen einigermaßen gelingt.
Amendt nimmt sich systematisch die kaum überbietbare Doppelmoral der offiziellen Drogenpolitik vor. Am deutlichsten offenbaren sich die Verhältnisse wie so oft beim Sport. Der feiert geradezu unmenschliche Leistungen und will wie ein Süchtiger immer mehr davon, doch verdammt man die naheliegende Hilfestellung der Chemie entrüstet. In Wahrheit habe, so der Autor, sich das Publikum doch längst mit den aufgeputschten Gladiatoren abgefunden, zu denen es seine Helden gemacht hat, und dopt sich im Fitneßstudio fleißig selber mit Muskelmitteln. Amendt beschreibt den zynischen Kampf der Tabaklobby, ihre Werbestrategien gegenüber Jugendlichen weiterhin zu legalisieren. Und der Tabak braucht immer neue Raucher, weil er die alten sukzessive umbringt - das hat ein großer Genußmittelkonzern erst jüngst in Tschechien den Politikern vorgerechnet und allen Ernstes als Wohltat für die Rentenkassen ausgerufen.
Amendt übersieht bei seiner packend geschriebenen Tour de force auch nicht die Drogenpräsenz im Mutterland des Kapitalismus. Die Millionen von gar zu trägen, gar zu hektischen Kindern, die mit Pillen in Amerika aufs Normalmaß gebracht werden, gehören genauso dazu wie Wachmacher gegen Schlafdefizit oder die Glücksdroge Prozac als Grundnahrungsmittel. Auch Viagra ist notabene eine gerngesehene Droge. Gleichzeitig sperren die Vereinigten Staaten viele hunderttausende, meist schwarze Bürger aus der Unterschicht nach Drogendelikten für viele Jahre ein und marginalisieren damit die Nutzer der nicht von der Chemie-Industrie und der Finanzverwaltung approbierten Glücksversprechen.
Auf diese Weise kommt es, so Amendt, zur "Medikalisierung sozialer Probleme": Der einzelne fühlt sich mit seiner Sucht allein, empfindet sich - und nicht die Mißstände, die er nicht mehr aushalten konnte - als Problem. Umgekehrt machen Drogen mindestens acht Prozent des Welthandelsvolumens aus. Diese Billionen Dollar und Euro landen in den Taschen internationaler Kartelle, die sogar den staatlichen Krieg gegen ihresgleichen - vorgeführt am amerikanischen Kreuzzug gegen das kaputtgebombte Kolumbien - zu steuern wissen.
Spätestens da wird dieser ohnehin politische Essay hochaktuell. Amendt zieht eine schlüssige Parallele zwischem dem schwer zu fassenden "Krieg gegen den Terror" und dem ebenso vagen Krieg gegen Drogen. So hat die Eroberung von Afghanistan durch westliche Militärs zu einem starken Anwachsen des Opiumanbaus geführt - aberwitzigerweise bewachen unsere Soldaten nun die Bauern und die Felder, deren Früchte später kriminell, meist über "befreundete Orientstaaten" in den Westen geschmuggelt werden und unsere Gesellschaft krank machen.
Wie er das todbringende Chaos beseitigen will, welche Drogenpolitik er selbst vorschlägt, das kann Amendt nicht ganz so schlüssig wie das Übel diagnostizieren. Er plädiert für einen etatistischen Ansatz, gemäß dem jedweder Verkauf und die Produktion von Drogen von Staats wegen reglementiert und kontrolliert sein sollen. Werbung für alle Arten von Drogen - und das reicht bei ihm von starkem Alkohol in Süßgetränken über Zigaretten bis zu Heroin und Kokain - möchte Amendt verboten sehen. In der vergleichsweise liberalen Haschischpolitik der Schweiz, die den relativ harmlosen Cannabiskonsum und -verkauf nicht mehr inkriminiert und dadurch sogar Steuergeld verdienen könnte, sieht Amendt zukunftsweisende Konzepte. Und auch Holland ist ja trotz seiner erheblich toleranteren Drogenpolitik nicht in Not geraten und kämpft auch nicht mit Massensucht.
Im Gegenzug zur Entkriminalisierung hofft Amendt nicht nur auf eine geringere Verführungskraft der Drogen, sondern baut ganz neoliberal auf die individuelle Vernunft: Dann muß ein jeder wie jetzt schon bei Wein oder Schnaps oder Zigarren mit dem verfügbaren Genußmittel zu Marktpreisen umzugehen lernen. Die verheerenden sozialen und materiellen Kosten der Drogen wären dann sehr viel besser zu überblicken, und es würde nicht mehr Sozialpolitik mit dem Polizei- und Gefängnis-Etat gemacht - auch das ein altliberaler Grundgedanke.
Daß dabei eine Gesellschaft ohne Drogen zustande kommen könnte, hält Amendt nicht für möglich, und er läßt auch offen, ob das überhaupt in der Theorie erstrebenswert wäre. "Wer von klein auf als Konsument heiß umworben ist, wer schon von früh darauf dressiert wurde, seine Glückserwartungen an Fetische zu binden, wer sein Selbstwertgefühl schon als Kind aus dem Besitz beziehungsweise aus dem Konsum von Statusgütern bezieht und wer eine Zukunft vor Augen hat, die mit angstmachenden Risiken gepflastert ist, wird sich nur schwer vom Konsum glückverheißender und Wohlbefinden versprechender Drogen abhalten lassen." Vielleicht, so könnte man die These dieses bewußtseinserweiternden Buches zuspitzen, ist ja der Kapitalismus selbst eine Droge - im Guten wie im Bösen. Das würde vieles von seinem Erfolg und von seinen Risiken erklären.
DIRK SCHÜMER
Günter Amendt: "No Drugs, no Future". Drogen im Zeitalter der Globalisierung. Europa Verlag, Hamburg 2003. 206 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
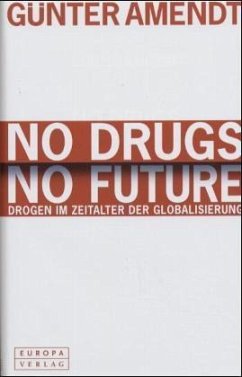




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.12.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.12.2003