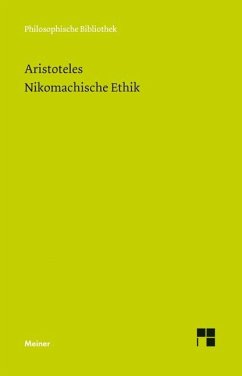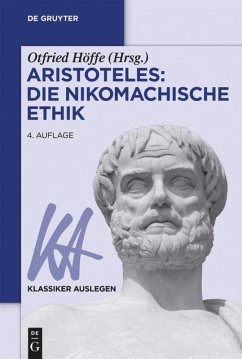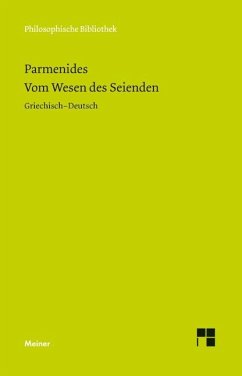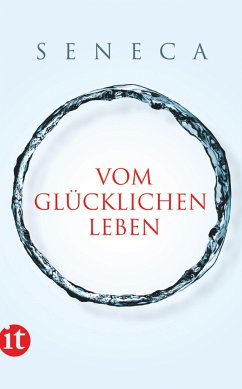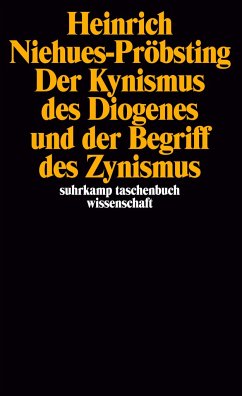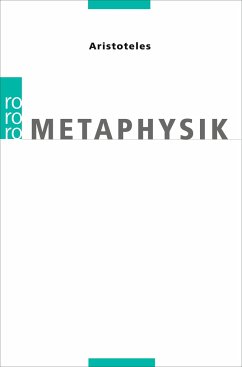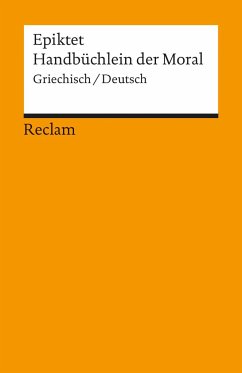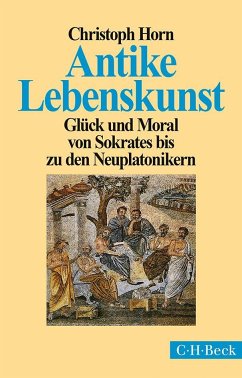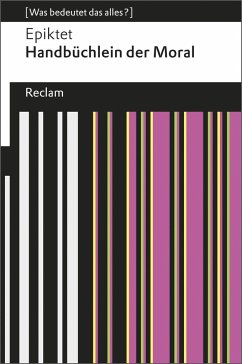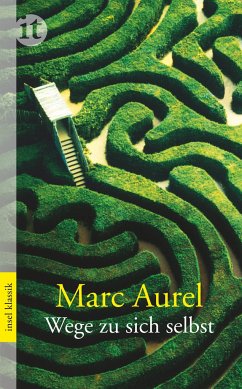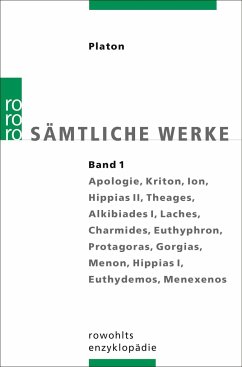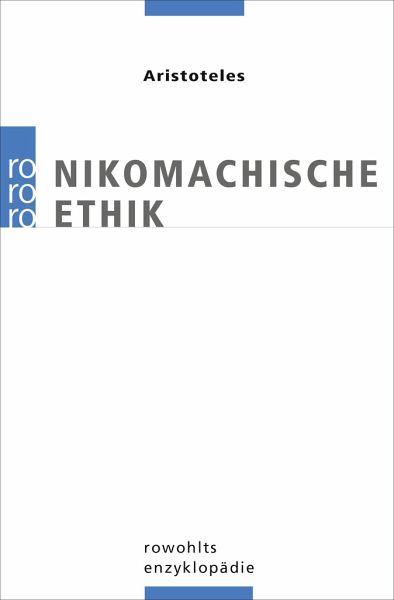
Nikomachische Ethik
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ursula Wolfs Neuübersetzung präsentiert den Text für den heutigen Leser handhabbar
Die Nikomachische Ethik ist einer der Grundtexte der Philosophie. In dieser Abhandlung entwickelt Aristoteles als erster eine systematische Begrifflichkeit für alle Bereiche des Denkens und Handelsn. Die NE entwirft ein Gesamtbild des praktischen Lebens und Zusammenlebens, das inhaltlich sämtliche wichtigen Teilaspekte behandelt, diese durch eine handlungstheoretische Begrifflichkeit differenziert erfasst und sie in ihrer Eigenart gegenüber den theoretischen Wissenschaften methodisch reflektiert. - Was Aristoteles im Bereich der Ethik geleistet hat, gehört nicht nur historisch zum Grundbestand abendländischer Kultur; es prägt noch heute die Begriffe, mit denen wir auf Mensch, Staat und Gesellschaft reflektieren.
Die zurzeit greifbaren deutschen Übersetzungen der Nikomachischen Ethik sind 50 oder mehr Jahre alt, philosophisch teilweise fragwürdig und sprachlich nicht mehr auf der Höhe. Ursula Wolfs Neuübersetzung präsentiert den Text für den heutigen Leser, insbesondere für Studierende, handhabbar, indem er durch Überschriften gegliedert wird; Übersetzungsprobleme werden angemerkt, die wichtigsten Termini auf Griechisch in Klammern zugefügt.
Die zurzeit greifbaren deutschen Übersetzungen der Nikomachischen Ethik sind 50 oder mehr Jahre alt, philosophisch teilweise fragwürdig und sprachlich nicht mehr auf der Höhe. Ursula Wolfs Neuübersetzung präsentiert den Text für den heutigen Leser, insbesondere für Studierende, handhabbar, indem er durch Überschriften gegliedert wird; Übersetzungsprobleme werden angemerkt, die wichtigsten Termini auf Griechisch in Klammern zugefügt.