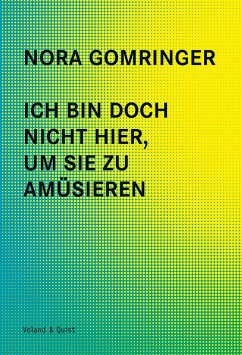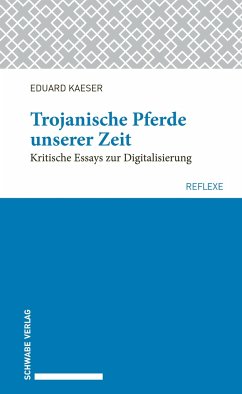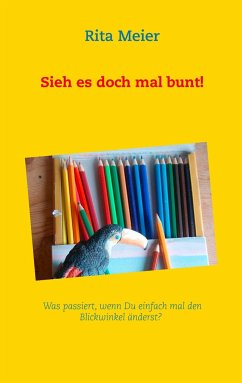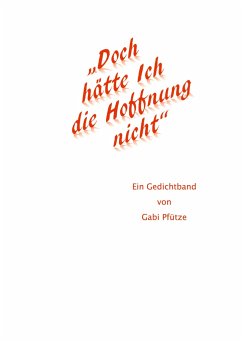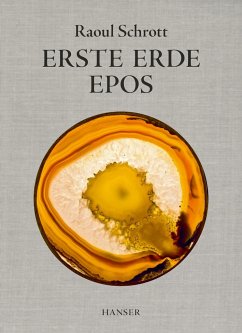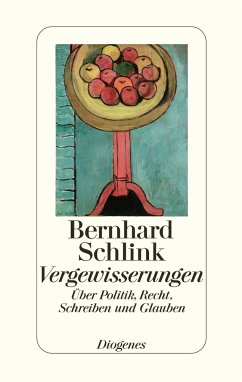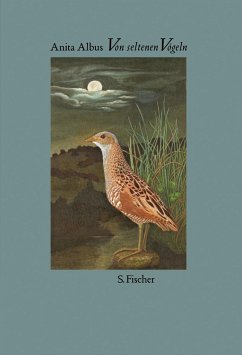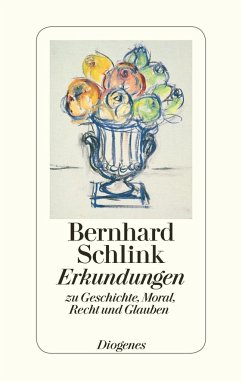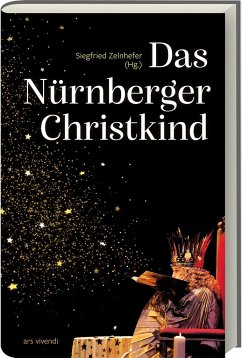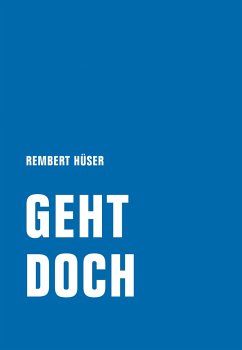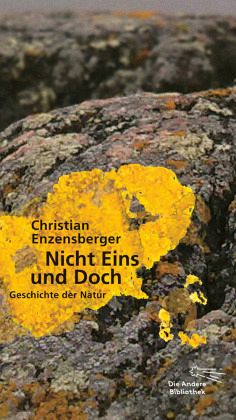
Nicht Eins und Doch
Geschichte der Natur
Mitarbeit: Ripplinger, Stefan; Linck, Dirck; Vogl, Joseph; Franck, Cornelia
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das stimmt ja nicht, schau mich doch an!" Das ruft nicht nur das Schöne, das rufen nicht nur die Steine, der Weidenbusch und der Fluss. Das ruft dieses ganze Buch, das ein großer Solitär in der deutschen Literatur ist und allein schon mit seiner Schönheit und mit seinem heiteren So-sein-Wollen und mit seinem Eros unserer abgewetzten, armen Welt ins Gesicht lacht. (Stefan Ripplinger) Weder Roman noch Essay, ist Nicht Eins und Doch eine große meditative Spekulation, gefügt aus Tausenden von nachgelassenen Blättern. Der "Naturgänger" Christian Enzensberger, der auch als Anglist, Essayist ...
Das stimmt ja nicht, schau mich doch an!" Das ruft nicht nur das Schöne, das rufen nicht nur die Steine, der Weidenbusch und der Fluss. Das ruft dieses ganze Buch, das ein großer Solitär in der deutschen Literatur ist und allein schon mit seiner Schönheit und mit seinem heiteren So-sein-Wollen und mit seinem Eros unserer abgewetzten, armen Welt ins Gesicht lacht. (Stefan Ripplinger) Weder Roman noch Essay, ist Nicht Eins und Doch eine große meditative Spekulation, gefügt aus Tausenden von nachgelassenen Blättern. Der "Naturgänger" Christian Enzensberger, der auch als Anglist, Essayist und Übersetzer zeitlebens zu faszinieren wusste, denkt nach, was Menschsein heißen kann in sinnlich-berührendem Umgang mit der Natur - am Leitfaden des Leibes, dem lebendigen Stoff. Der wird diesem im Buch der Natur lesenden Spaziergänger zum Maß des Menschen. Nicht Eins und Doch trägt Einspruch und Beharren schon im Titel. Dieser literarische Monolith nähert sich in langer philosophierender Tradition, anschaulich denkend und spürend, einer "Sprache der Natur" in hingebungsvoll - dramatischer Zwiesprache mit allem Nahen und scheinbar Nichtigen. Aus solcher Betrachtung erwächst uns Lesern lustvolle Belehrung. Buchkünstlerin: Cornelia Franck
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.