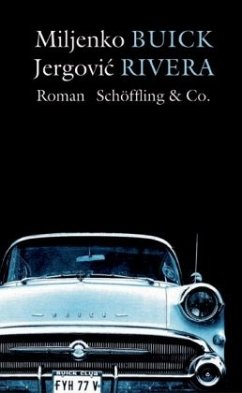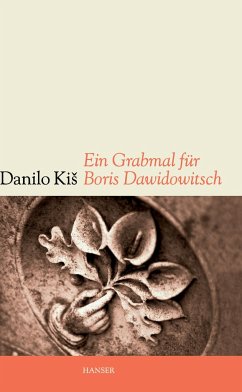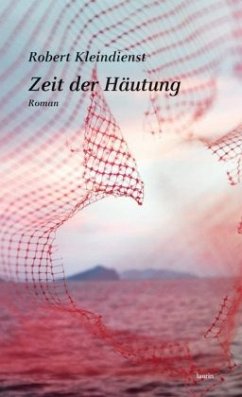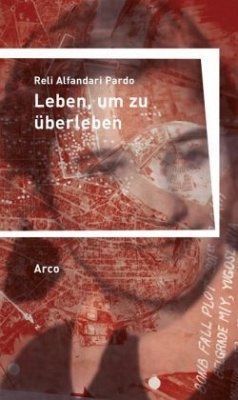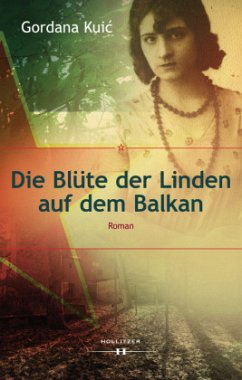Stockwerk über seinem Kinderzimmer fast ein Jahr lang auf den Tod gewartet. Das Sterben der Mutter hat er Nevena verschwiegen. Deren groteske Familiengeschichten vom Balkan faszinieren ihn hingegen ungemein.
Im Spiel selbst ist Nevena ein kriegerischer Barbar mit Kampfnamen Mr. Smith, während Patrick als dessen Schutzelfe Pocahonta agiert, ihn also mit Zauberkräften vor Verwundungen bewahrt oder die Feinde auf dem Schlachtfeld mittels magischer Energie lähmt. Als die beiden gerade im Begriff sind, einen gewaltigen Minotaurus zur Strecke zu bringen, blinkt in Patricks Chatfenster eine Kurznachricht auf. "Gtg, sorry", lautet sie. "Got to go" meint das, Nevena signalisiert, sie müsse das Spiel mal eben kurz verlassen.
Fortan jedoch bleibt sie verschwunden, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat, wie aus allen Maschen des Internets gefallen und wie vom Erdboden verschluckt. Patrick versteht die Welt nicht mehr. Klar wird ihm überdies, dass er trotz der vielen Geschichten, die sie ihm auftischte, so gut wie nichts über die wirkliche Nevena weiß, noch nicht einmal ihren Nachnamen kennt er. Und da sie auch keinen Facebook-Eintrag hat, ist sie im Grunde inexistent.
Es ist zunächst überaus reizvoll, am Erzählspiel des Burkhard Spinnen teilzunehmen. Geschickt, gekonnt, ja elegant springt er zwischen realer und virtueller Welt hin und her. Henner, Patricks Vater und jetzt "ein Witwer um die Fünfzig", hat mit Astrids Tod auch die Aufgabe verloren, die ihn aufrecht hielt, die Pflege seiner Frau. Es ist ein elegisches, dabei psychologisch sehr präzises Porträt, das der Roman von diesem jetzt verzagten, immer antriebsloser werdenden Mann zeichnet - und von seinem so stillen wie heroischen Kampf, die einstige beruflichen Energie wenigstens nicht ganz zu verlieren. Henner ist Restaurator in einem Museum.
Patrick fahndet derweil im Netz nach irgendeiner Nevena-Spur, ohne seine Partnerin schleicht er auch wieder durchs Computerspiel, für das sich Spinnen - so verrät er in der Danksagung - am Internethit "World of Warcraft" orientiert hat. Vater und Sohn jedenfalls sind zwei Verlorene, die auch aneinander keinen rechten Halt finden, obwohl sie es immerhin versuchen: gemeinsames Frühstück, mal zusammen fernsehen, Henners Besuch in Patricks digitalem Universum, "dieser Pixelwalachei", Patricks bemühtes Interesse an dem alten Möbelstück, das sein Vater wieder auf Vordermann bringen will.
Merkwürdigerweise aber verliert der Roman an Intensität, wenn er den Stillstand im Trauerhaus verlässt, um handlungsheftig in Bewegung zu geraten. Nach gut hundert Seiten brechen die beiden auf - Henner hat einen Auftrag in Triest angenommen, Patrick hofft, in einem Ferienhotel an der kroatischen Küste den Schlüssel zu Nevenas Geheimnis zu finden. Zum road novel wird das Buch gleich in der Frankfurter Vorstadtgarage. Denn dort steht Astrids liebstes Stück - ein Wohnmobil aus den endsiebziger Jahren, ein kaum noch fahrbares Fossil, das auf den etwas zu possierlichen Namen "Erich" hört.
Ein Erzählmeister ist Burkhard Spinnen, wenn er kleine deutsche Wirklichkeiten schildert, Fußgängerzonen, Supermärkte, Bushaltestellen, wenn er, wie in seinem wunderbaren Roman "Langer Samstag" (1995) oder wie im ersten Teil des neuen Buchs deutsche Kleinbürger zu Helden mit tragikomischem wie tragischem Potential macht. Südeuropäische Städteporträts sind seine Sache nicht so ganz - wir fahren mit "Erich" nun aber von Triest über Opatija, Rijeka und Mostar bis nach Sarajevo. Ganz unvermeidlich kommt dabei auch einheimisches Personal ins Bild, Mirko, der Kellner mit dem Gipsarm etwa, Alex, der Fremdenführer aus Mostar, Ivan Maric, der halbverrückte Müllwerker, von dem es heißt, er sei im jugoslawischen Bürgerkrieg "ein hohes Tier" gewesen - von Spinnen geschildert, wirken sie bisweilen wie bloße Staffage. Den Schreckenszeugnissen des Jugoslawien-Kriegs begegnet das Buch mit großem Ernst. "Das wäre mein Krieg gewesen", geht es Henner einmal durch den Kopf, "für den", fügt der anonyme Erzähler gleich hinzu, "hätte er das richtige Alter gehabt".
Aus Vater und Sohn sind inzwischen entschlossene Amateurdetektive geworden. Aber je mehr sie in der fremden Welt recherchieren, desto dringlicher wird es für ihren Autor, die Geschehnisse und die Figuren einigermaßen plausibel zu halten. Der krimiähnliche Konstruktionsaufwand ist beträchtlich - und wirkt nicht selten bemüht. Nevena, das wird bald klar, hat ihre Balkan-Grotesken ebenso erfunden wie ihre serbische Identität. Der Roman gewährt diesen Lügen die Weihe der Not und lässt ihre Motive zumindest nachvollziehbar, wenn nicht gar edel erscheinen. Glaubhaft machen kann er jedoch nie, warum sie den armen Patrick, in den sie fernverliebt ist, so sehr und dauerhaft ins Bockshorn gejagt hat.
Am Ende schafft es "Erich" mit Ach und Krach wieder ins Frankfurter Umland - und der Roman ins friedliche Finale an Patricks PC und Nevenas Laptop. Burkhard Spinnen kann mehr.
Burkhard Spinnen: "Nevena". Roman.
Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2012. 394 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
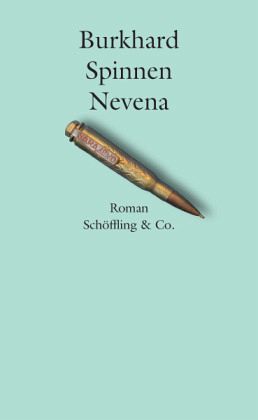





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2012