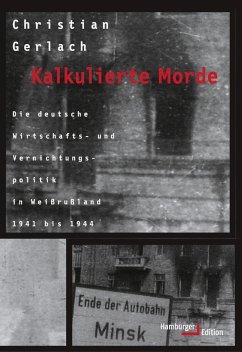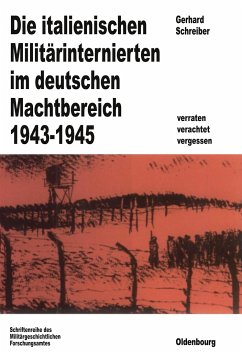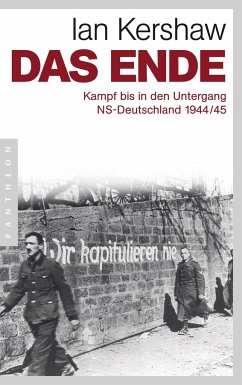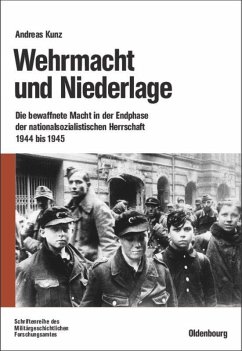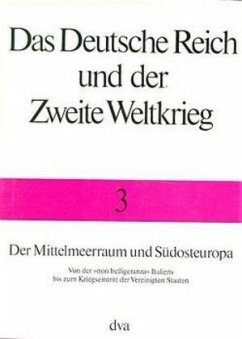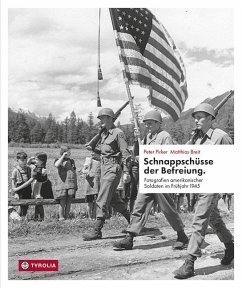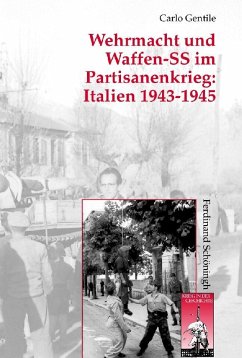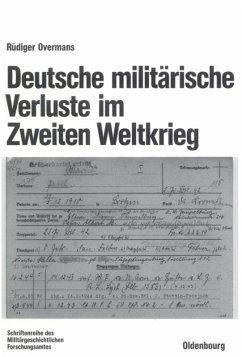sowie die von den Faschisten annektierte jugoslawische Provinz Ljubljana umfaßten. Im Vergleich zum "Generalgouvernement" in Polen oder auch zu Elsaß und Lothringen handelte es sich dabei um eher unbedeutende Auswüchse des nationalsozialistischen Imperialismus.
Auch ist festzustellen, daß es sich bei den beiden Besatzungsgebieten nur um Teilgebiete des von den Deutschen nach dem 8. September 1943 völkerrechtswidrig besetzten und zerstückelten Oberitalien handelte. Sehr viel bedeutender war für die Besatzer das Gebiet der Repubblica Sociale Italiana, der für Mussolini nach seiner Befreiung eingerichteten Satellitenrepublik. Ihre Errichtung und ihre politische Funktion im nationalsozialistischen Herrschaftssystem ist von Lutz Klinkhammer ausführlich beschrieben worden. Dieser wies auch den Weg, den Wedekind jetzt ebenfalls gegangen ist. Das nationalsozialistische Besatzungsregime in den beiden Operationszonen wird von ihm als Fallbeispiel polykratischer Herrschaft interpretiert, wobei die Tragfähigkeit dieses Interpretationsansatzes von ihm freilich nicht methodisch reflektiert wird.
Im Ergebnis ist Wedekinds Darstellung aber insofern überzeugend, als er nachweisen kann, daß die Abtrennung der beiden Besatzungsgebiete nicht militärischer Notwendigkeit entsprang, wie der Begriff der "Operationszonen" nahelegen könnte. Es kann vielmehr kein Zweifel daran bestehen, daß es österreichische NS-Führer, in erster Linie die beiden Gauleiter Hofer (Tirol) und Rainer (Kärnten), waren, welche diese aus rein politischen Gründen durchgesetzt haben. Nach Wedekind standen sie in einer spezifisch österreichischen Tradition kontinentalimperialistischen Denkens, wie es von dem Geopolitiker Karl Haushofer oder dem Volkstumsfanatiker Felix Kraus ideologisch ausgeformt worden ist. Es sei dahingestellt, inwieweit es hier tatsächlich ideologische Verbindungslinien gab. Jedoch steht fest, daß die Gauleiter und die um sie herum gescharten österreichischen Nationalsozialisten klare expansionistische Ziele hatten.
Es ist verblüffend, wie leicht sich die Austroimperialisten bei Hitler durchsetzen konnten. Selbst Joachim von Ribbentrop, dessen italienischer Statthalter Rudolf Rahn in Mussolinis Sozialrepublik das Sagen hatte, verzichtete stillschweigend auf eine Machtausübung in den Operationszonen. Wie so oft im "Dritten Reich" war dafür entscheidend, daß die beiden Gauleiter einen direkten Zugang zum Herrscher hatten. Über Martin Bormann, der in der Endphase des nationalsozialistischen Regimes faktisch die Parteiführung innehatte, konnten sie Hitler schon vor dem befürchteten italienischen Waffenstillstand dazu bewegen, ihnen als Gauleitern eine persönliche Herrschaftserweiterung im Südosten zuzugestehen. Als es dann am 8. September 1943 soweit war, bestätigte Hitler schon am 9. September durch einen schriftlichen Befehl den künftigen Sonderstatus der beiden Operationszonen, während er den Status des übrigen besetzten Italiens erst einen Tag später fixierte. Hofer wurde zum "Obersten Kommissar" für das Alpenvorland und Rainer zum "Obersten Kommissar" für das Adriatische Küstenland ernannt.
Wedekind glaubt, die von ihm herausgearbeitete und in allen Einzelheiten (unter anderem in den Bereichen der Wirtschaftspolitik, der Zwangsarbeit, der Bewußtseinssteuerung und der Rassenpolitik) beschriebene Sonderherrschaft der beiden Gauleiter als eine Art Zwischenschritt zu einer vollständigen "deutschen Beherrschung des europäischen Südostens" interpretieren zu können. Das ist jedoch eine fragwürdige These. Wie beispielsweise im Fall der Ausdehnung der Parteiherrschaft des Gauleiters Simon auf Luxemburg verbot Hitler bezeichnenderweise auch in den südosteuropäischen Operationszonen jegliche staats- und völkerrechtliche Festlegung. Erst nach dem siegreichen Weltkrieg wollte er entscheiden, wie das großgermanische Reich nationalsozialistischer Nation einmal aussehen sollte.
Besonders eindringlich hat Wedekind die "Gewaltentfesselung des NS-Repressionsapparates" in den Operationszonen beschrieben. Das gilt vor allem für die rücksichtslose Verfolgung der Juden, aber auch für den Kampf gegen slowenische, kroatische und italienische Partisanen. Die Repression war nicht zuletzt deshalb so brutal, weil sie von Schergen wie dem Kärntner Odilo Globocnik gesteuert wurde, der im Osten, beginnend mit der "Aktion Reinhard", seine ersten Vernichtungsaktivitäten ausgeübt hatte. Das Lager in einer ehemaligen Reisfabrik im Triester Stadtteil San Sabba, in dem es zur Massentötung von Häftlingen kam, gilt nicht zu Unrecht bis heute als Symbol dieser Vernichtungspolitik. Es ist wichtig, daß Wedekind dies in einen größeren historischen Zusammenhang stellt.
In der Operationszone Alpenvorland kam es, mit Ausnahme der rein italienischsprachigen Provinz Belluno, nicht zu solchen Exzessen wie im Adriatischen Küstenland. Die deutsche Besatzung konnte hier zumindest in Südtirol mit einer "Dominanz der Solidarisierung" rechnen. Mit Nachdruck weist Wedekind - wie freilich schon vorher der von ihm nicht berücksichtigte Rolf Steininger - darauf hin, daß die Zustimmung der deutschsprachigen Südtiroler zur Verfolgung von Juden, Italienern oder politischen Oppositionellen trotz einer auch sie betreffenden Verschärfung der Repressionspolitik bis zum bitteren Ende anhielt.
WOLFGANG SCHIEDER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
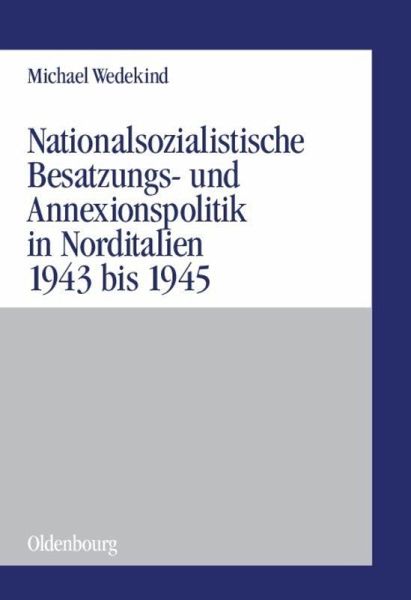






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2003