Freikorps- und Wehrverbandsszene der zwanziger Jahre, längst enttäuschte Wegbereiter des Nationalsozialismus, erklärten sich bereit, in die Reichskanzlei einzudringen. Heinz schwebte damals eine moderne Variante der Hohenzollern-Monarchie vor - mit seinem Freund Prinz Wilhelm (Sohn des gleichnamigen und durch die Flucht nach Holland im November 1918 in Verruf gekommenen Kronprinzen) als "deutscher Volkskönig" und Staatsoberhaupt.
Der nationalrevolutionäre Aktivist der ersten Stunde verfügte über umfangreiche terroristische Erfahrungen. Mit der "Brigade Ehrhardt" nahm Heinz 1920 am Kapp-Putsch und mit der SA 1923 am Hitler-Putsch teil, als regionaler Leiter der berühmt-berüchtigten "Organisation Consul" und des Nachfolgeverbandes "Bund Wiking" war er in Fememorde und Attentate auf Erzberger, Scheidemann und Rathenau verstrickt. Nacheinander hatte er herausgehobene Positionen im "Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten", in der SA, im Strasser-Flügel der NSDAP und wieder im "Stahlhelm" inne. Auch als Redner, Romanautor und Redakteur trat Heinz hervor. Im Mai 1927 zog er sogar gegen den vorgespielten Frontsoldaten-Habitus von Joseph Goebbels zu Felde und warf ihm "nationalsozialistisches Maulheldentum" vor; die Frontkämpfer des Weltkrieges waren noch darauf bedacht, sich von den Straßenschlägern der NSDAP abzusetzen. Heinz propagierte den "nationalen Sozialismus" der Strasser-Brüder, was im Frühjahr 1930 zum Ausschluss aus der NSDAP führte. Trotzdem bemühte er sich um Wiederaufnahme, doch Parteiführer Hitler entschied höchstpersönlich, dass "F.W. Heinz nie mehr in die Partei aufgenommen wird".
Kurze Zeit leitete Heinz das Büro des Freikorpsveteranen Korvettenkapitän a.D. Hermann Ehrhardt und verfasste den Roman "Sprengstoff". Dabei stand nicht - wie etwa bei Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" - das Fronterlebnis im Mittelpunkt, sondern das gegen die Weimarer Republik gerichtete Freikorpslebensgefühl.
Der "Stahlhelm"-Führer musste 1933 nach der "Machtergreifung" zunächst tatenlos zusehen, wie der Frontsoldatenbund zum reinen Kriegsveteranenverein degradiert wurde. Beruflich ging es erst wieder aufwärts, als der Ehrhardt-Intimus Wilhelm Canaris 1935 die Leitung des Amtes Ausland/Abwehr übernahm. Zum 1. April 1936 trat Heinz in das Referat III c 3 ein und überwachte die Zeitungspresse und den Buchmarkt; insbesondere Spionagereißer und autobiographische Berichte aus der Fremdenlegion waren dem Amtschef, der selbst den Nimbus des Meisterspions pflegte, ein Dorn im Auge.
Susanne Meinls Bochumer Dissertation über Heinz und sein Umfeld untersucht ein kaum erforschtes Kapitel deutscher Militärgeschichte. Das persönliche Netz zwischen den Aktivisten der völkisch-radikalen Freikorps, Wehrverbände und Geheimbünde legt sie überzeugend frei und bietet eine wahre Fundgrube bisher unbekannter biographischer Details.
Ausgerechnet die Abenteurer- und Landsknechtsnaturen um Heinz waren im September 1938 Hitlers Todfeinde. Sie unterschieden sich fundamental von der eher informellen "Antikriegs-Partei" (so Klaus-Jürgen Müller) in Militär und Diplomatie, die sich im Frühjahr/Sommer 1938 aus Kriegsfurcht formiert hatte. Hohe Amtsträger - unter ihnen Canaris, Generalstabschef Halder und Staatssekretär von Weizsäcker - wollten den durch Reichsaußenminister von Ribbentrop angeblich nur schlecht beratenen Hitler von einem kleinen Krieg gegen die Tschechoslowakei abhalten, weil daraus allzu leicht ein großer Krieg gegen die Westmächte entstünde. Sie zogen einen Staatsstreich - wenn überhaupt - höchstens als verzweifelten letzten Schritt bei einem Angriffsbefehl Hitlers in Betracht. Im Grunde waren sie überzeugt, dass ein vielleicht scheiternder Putsch einen Weltkrieg oder ein erfolgreicher Umsturz sogar einen Bürgerkrieg auslösen würde.
Im Verantwortungsbereich der Repräsentanten der "Antikriegs-Partei" fanden überzeugte Gegner des Nationalsozialismus zusammen, die den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes durchschaut hatten und Hitlers Vabanquepolitik in der Krise um die Tschechoslowakei zum Anlass für einen Coup d'État nehmen wollten. Treibende Kräfte waren neben Oster der Kommandeur des Wehrkreises III, Erwin von Witzleben, Regierungsrat Hans-Bernd Gisevius und andere. Die Verschwörer fürchteten, dass eine Ermordung Hitlers zu einer Neuauflage der Dolchstoßlegende führen könnte. Daher kam für sie nur eine Festnahme Hitlers und anschließend dessen Verurteilung vor einem Tribunal oder aber Hitlers fachärztliche Untersuchung zur Einweisung in eine geschlossene Anstalt in Frage.
Solche Bedenken mussten den Stoßtrupp-Leuten um Heinz weltfremd vorkommen. Weil sie übrigens nie in der ihnen zugedachten Funktion zusammenkamen, darf man sich die Attentätergruppe eher als eine Namensliste und keinesfalls als ein entsprechend trainiertes Himmelfahrtskommando vorstellen.
Eine große Schwäche aller drei Fraktionen innerhalb der heterogenen "Septemberverschwörung" bestand darin, dass sie das eigene Handeln abhängig machten "von äußeren Faktoren, die sie kaum beeinflussen konnten". Mit dem Münchener Abkommen lenkte Hitler ein, so dass die "Antikriegs-Partei" in Berlin die Rettung des Friedens als großen Erfolg ansah.
Heinz und andere Nationalrevolutionäre gehörten während des Zweiten Weltkrieges zeitweise der legendären Abwehr-Einheit "Brandenburg" an, die schnell von Regiments- auf Divisionsstärke anwuchs. Trotz gezielter Personalpolitik gelang es Hans Oster nicht, als Lehre aus den Erfahrungen des Septembers 1938 die neue Verfügungstruppe der Abwehr zu einer Staatsstreichtruppe des Widerstandes umzufunktionieren. Daher war beispielsweise Heinz in die unmittelbaren Vorbereitungen des Stauffenberg-Attentats offensichtlich nur ganz am Rande eingeweiht. Allerdings erlebte der zum Leiter des Wehrmachtstreifendienstes im Wehrkreis III abgestiegene schwatzhafte Abwehrspezialist den 20. Juli 1944 unmittelbar an einem Hauptort des Geschehens - im Bendlerblock. Später vorübergehend verhaftet, tauchte er schließlich in Berlin unter - und 1950 in Bad Godesberg wieder auf. Zum Leiter des Nachrichtendienstes im Bundeskanzleramt gekürt, konnte er sich bis zu seiner Ablösung im Jahr 1953 in Konkurrenz zur Organisation Gehlen und zum Bundesamt für Verfassungsschutz noch einmal im alten Metier ausleben.
Die ungewöhnliche Wiederverwendung lastet Susanne Meinl dem Leiter der Hauptabteilung für innere Angelegenheiten und späteren Chef des Bundeskanzleramtes, Hans Globke, an. Unter ihm habe die nationalsozialistische Vergangenheit von Mitarbeitern wie Heinz keine Rolle gespielt, ja, sei "als lässliche Jugendsünde betrachtet" worden. Nahe liegender ist es sicherlich, die Bundesrepublik-Karriere des Friedrich Wilhelm Heinz mit seiner nachrichtendienstlichen Tätigkeit für die Alliierten nach 1945 und mit seiner undurchsichtigen Widerstandsvita zu erklären.
RAINER BLASIUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
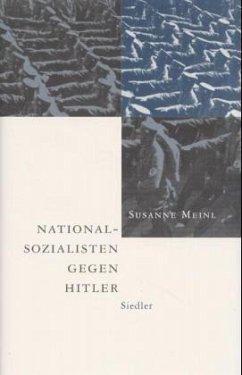




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.06.2000