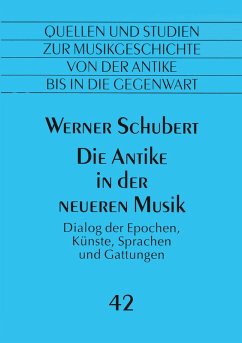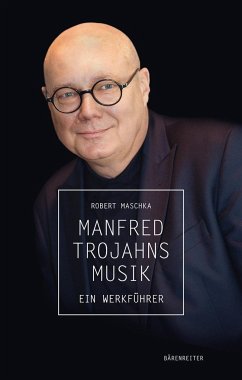Muss ich das Programmheft lesen?
Zur populärwissenschaftlichen Darstellung von Musik seit 1945
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
69,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Welche Bedeutung hat Wissen über Musik für den Konzertbesuch? Christiane Tewinkel diskutiert am Beispiel von Musikeinführungen und Programmheften der Berliner und Münchner Philharmoniker die historische Doppelfunktion des Programmhefts als Instrument einerseits zur Einladung und andererseits zur Ausgrenzung.Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Innovationen im Konzertwesen und in der Einführungsliteratur und zeichnet nach, über welche Personen und Netzwerke sich die institutionalisierte Musikwissenschaft mit der freien Musikpublizistik verbunden hat. So wird analysiert, wie sich W...
Welche Bedeutung hat Wissen über Musik für den Konzertbesuch? Christiane Tewinkel diskutiert am Beispiel von Musikeinführungen und Programmheften der Berliner und Münchner Philharmoniker die historische Doppelfunktion des Programmhefts als Instrument einerseits zur Einladung und andererseits zur Ausgrenzung.Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Innovationen im Konzertwesen und in der Einführungsliteratur und zeichnet nach, über welche Personen und Netzwerke sich die institutionalisierte Musikwissenschaft mit der freien Musikpublizistik verbunden hat. So wird analysiert, wie sich Wissensformen und Wissensbestände zur Musik seit 1945 konsolidiert und verbreitet haben.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.