verkauft Myristica fragrans, vulgo Muskatnuß, acht Stück für 5,30 Mark, und das reicht aus, um eine ganze Familie, einschließlich Hund und Bediensteten, von der Pest zu heilen.
Die Muskatnuß war wohl so etwas wie die EM.TV-Aktie des siebzehnten Jahrhunderts. Bekanntlich wiederholen sich die Tragödien der Geschichte als Farce, und wer Augen hat zu sehen, erkennt im Neuen Markt die Ostindischen Kompanien wieder. Die Ingredienzien gleichen sich: Ein nicht völlig nutzloses, aber doch total überbewertetes Produkt, Spekulanten, die beim Gedanken an ihren künftigen Reichtum ein kaltes Glitzern in den Augen bekommen und am Ende der Hierarchie die bedauernswerten Menschen, die für ungewisse Versprechungen die eigentliche Arbeit machen. Immerhin ist ein gewisser Fortschritt festzustellen. Früher starben die Matrosen am Skorbut, heute feiern die entlassenen Internet-Programmierer pink slip parties.
Giles Milton hat mit "Muskatnuß und Musketen" ein wunderbares Buch über "Europas Wettlauf nach Ostindien" geschrieben. Alles begann mit völliger Unwissenheit. Im Mittelalter bezog man Gewürze - Muskatnuß, Gewürznelken, Pfeffer, Zimt - aus Venedig. Die Venezianer hatten ihrerseits Lieferanten in Konstantinopel. Dann verloren sich aber die Spuren in den unendlichen Weiten Asiens. Wo die Ware eigentlich herkam, wußte man nicht. Milton erzählt hauptsächlich von der Muskatnuß: wie ihr Herkunftsort langsam bekannt wurde und wie sich tollkühne Seefahrer aufmachten, um die kostbare Knolle unter Ausschaltung des Zwischenhandels zu importieren.
Er ist Engländer, und er erzählt aus Londoner Sicht. Für ihn sind seine Landsleute, nun ja, nicht wirklich moralisch hochstehend, aber doch irgendwie die minderen Schurken. Wenn der englische David gegen den holländischen Riesen Goliath kämpft, dann gehört ihm Miltons Sympathie, auch wenn diesem klar ist, daß David genauso seine menschlichen Schwächen hat.
Die Muskatnuß wuchs im Elisabethanischen Zeitalter nur auf den Bandainseln, die etwa zweitausend Kilometer östlich von Jakarta liegen. Der wichtigste Erzeugungsort war die kleine Insel Run, die man heutzutage in den wenigsten Atlanten verzeichnet findet. (Als mißtrauischer Rezensent prüft man so etwas natürlich nach: Im Großen Knaur findet man die Insel, wenn man sie nicht für Fliegendreck hält.) Ein Blick auf den Globus lehrt uns sofort, daß man Run von Europa auf dem Seeweg am besten durch den Suez-Kanal erreicht. Nur gab es damals ja noch keinen ordentlichen Globus, geschweige denn etwa einen Suez-Kanal. Deshalb war es am vernünftigsten, um das Kap der Guten Hoffnung herum zu fahren, aber es dauerte eine gewisse Zeit, ehe man das begriffen hatte.
Als erste Europäer kamen die Portugiesen 1511 zu den Bandainseln. Wegen der widrigen Meeresströmungen und der feindseligen Eingeborenen verloren sie aber das Interesse. Der große Streit wurde zwischen den Briten und den Holländern ausgefochten. Milton schildert die erfolgreichen und die gescheiterten Versuche der Briten, zu den Bandainseln zu gelangen und mit dem Schiff voller Gewürze dann wieder in die Heimat zurückzukehren. Man versuchte es vergeblich über das antarktische Eismeer, man glaubte zu Unrecht, der Fluß Hudson sei die Passage vom Atlantik zum Pazifik, und manchmal kam man sogar am Ziel an. William Keeling ließ seine Matrosen auf der Reise Theater spielen: "Wir gaben das Trauerstyck des Hamlett." Im Original heißt das Buch "Nathaniel's Nutmeg" - Nathaniel Courthope ist Miltons Held, der es schafft, fünf Jahre lang mit dreißig Mann die Insel Run gegen eine holländische Übermacht zu halten, bis er verraten und umgebracht wird.
Am Schluß einigten sich die Briten und die Holländer im Vertrag von Breda 1667. Die Holländer bekamen Run, dafür erhielten die Briten ein anderes Inselchen namens Manna-hata in der Mündung des Hudson, das die Holländer den örtlichen Eingeborenen für sechzig Gulden abgekauft hatten. Leider sind die Grundstückspreise in Manhattan erst so richtig gestiegen, nachdem die Briten dort schon wieder rausgeflogen waren. Aber Run war auch kein besonderes Schnäppchen, weil sich herausstellte, daß die Muskatnuß sich auch anderswo anpflanzen ließ und dort prächtig gedieh. Wie gewonnen, so zerronnen; aber das ist ja heute bei den Dotcoms auch nicht anders.
Ulrich Enderwitz hat das Buch angenehm übersetzt. Für die Zitate hat er ein sehr altertümliches Deutsch gewählt. Ob es authentisch ist, kann man als Laie nicht beurteilen, aber es klingt gut. Ein Beispiel von Hunderten: "Und da er mit ihnen hineingegangen, fand er den Wald voll mit Schwarzmohren, Bandanesen und orang kayas, von denen sie sogleich umzingelt, und ohn daß viel Worte zwischen ihnen wärn gewechselt worden, wurden sie von denen ungetreuen Schurken massakriret."
Der Kollege vom "Independent" empfiehlt, das Buch zu lesen, wieder zu lesen und seinen Kindern vorzulesen. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dem Hinweis, daß man es den Kindern wirklich nur vorlesen darf. Gewisse Folterszenen muß man dabei dezent übergehen.
ERNST HORST
Giles Milton: "Muskatnuß und Musketen". Europas Wettlauf nach Ostindien. Aus dem Englischen von Ulrich Enderwitz. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2001. 448 S., Abb., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
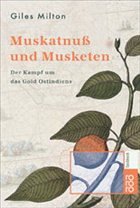




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.05.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.05.2001