"Book Reviews" der "New York Times", der "Washington Post" und für Magazine wie "Vanity Fair" oder "Harper's", vor allem aber für das linksliberale Magazin "The Nation" den Zusammenhängen von Musik, Gesellschaft und Politik nachgespürt.
Über vierzig Essays, Rezensionen und Buchbesprechungen wurden 2008 von Columbia University Press veröffentlicht; sechsunddreißig davon finden sich in einem Band der Edition Elke Heidenreich unter dem Titel "Musik ohne Grenzen", der den Sinn des Originaltitels "Music at the Limits" umkehrt. Said gehörte nicht zu denen, welche die grenzüberschreitende Kraft der Musik beschwören, sondern zu den Skeptikern, die beobachten, wie die Musik durch den Musikbetrieb, durch Kommerzialisierung und ideologische Vereinnahmung "at the limits" gelangt.
Daniel Barenboim, der mit ihm das West-Eastern Divan Orchestra gründete, schreibt in seinem Vorwort, Said habe seine musikalischen Reisen zu einem Zeitpunkt begonnen, "als die Bedeutung der Musik in der Gesellschaft zu schwinden begann". Er rühmt den "bemerkenswerten Interessenhorizont" des langjährigen Freundes, der "sich vorzüglich in der Kunst der Komposition und Orchestrierung" auskannte. Said wird seiner Reputation gerecht, wenn er etwa in seiner klug abwägenden Rezension John Adams "Death of Klinghoffer" und den Regisseur Peter Sellars gegen jene neokonservativen Kritiker verteidigt, die das Werk als "ideologisch" verwerfen; ebenso, wenn er sich gegen den konservativen Inszenierungsstil der Metropolitan Opera wendet, durch den viele Werke - gerade Wagners "Ring" - ins Grab der Tradition gelegt werden.
Drei Aufsätze sind Glenn Gould gewidmet, den Said insbesondere deshalb zum Idol erhebt, weil er Virtuose und Intellektueller war und seine Laufbahn teleologisch angesehen hat - als ein künstlerisches Projekt -, während er bei etlichen anderen den Weg in die Erstarrung und Routine beobachtet, insbesondere bei Vladimir Ashkenazy, aber auch bei dem zunächst bewunderten Maurizio Pollini. Dass Said sich in seinen Rezensionen auch durch sein "akribisches Interesse am Detail" (Barenboim) ausgezeichnet habe, ist allerdings selten zu erkennen. Anders als Joachim Kaiser oder Jens Hagestedt beschreibt er nicht Goulds Stil - oder die Manier -, vielmehr betreibt er, hymnisch raunend, Heldenanbetung.
Saids Urteile über Komponisten wie Interpreten, ob Pianisten oder Sänger, sind pauschal, etliche haarsträubend. "Gemessen an seinen eigenen, außerordentlichen Ansprüchen kann sich Händel sicherlich mit Bach messen, was Technik und Perfektion angeht." Wagner sei sich des "kataklystischen Untergangsszenarios" der "Götterdämmerung" nicht bewusst gewesen. Bernd Alois Zimmermann, dessen "Soldaten" er in der New York City Opera hörte, ist nach seiner Ansicht "ein sehr unzulänglicher Komponist, weil er so geradlinig und undramatisch daherkommt". Der "Aida" des von ihm ungeliebten Verdi bescheinigt er "eine überentwickelte Partitur" und eine "unterentwickelte Geschichte".
Um Details hat sich auch das Lektorat nicht geschert. Ein 1986 geschriebener Aufsatz über den 1957 gestorbenen Strauss beginnt der Feststellung: "Fast ein Jahrhundert nach seinem Tod ist Richard Strauss' Rolle in der Musik des 20. Jahrhunderts nach wie vor eine offene Frage." Said datiert die Gründung der Salzburger Festspiele auf 1877 zurück, verlegt den Maggio Musicale Fiorentino nach Venedig und beschreibt András Schiff als "cherubinisch" aussehenden Pianisten. Aus Zoltán Kocsis wird Kocis, aus "Pelléas et Mélisande" mal "Péleas", mal "Pelleas et Melisande", und Schönbergs "Erwartung" vergrößert sich im Verlauf einer Rezension zu "Erwartungen". Die Herausgeberin sollte auf eine Revision dringen und Sorge tragen, dass die ersten 26 Kapitel so flüssig und sinnvoll übersetzt werden wie die letzten sechs.
JÜRGEN KESTING
Edward W. Said: "Musik ohne Grenzen". Mit einem Vorwort von Daniel Barenboim.
Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann, München 2010. 416 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
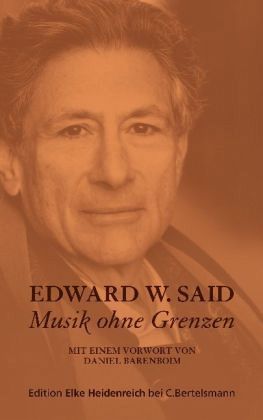





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2011