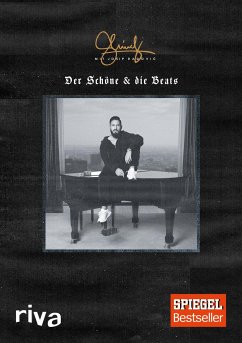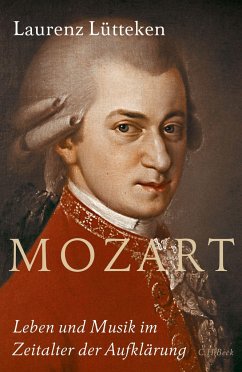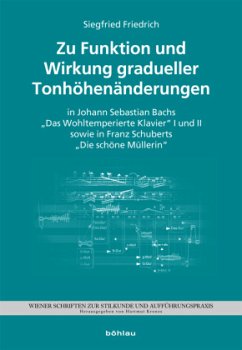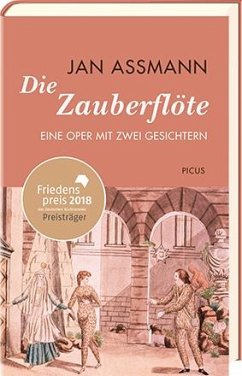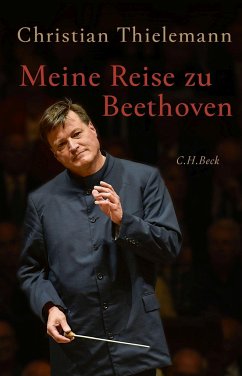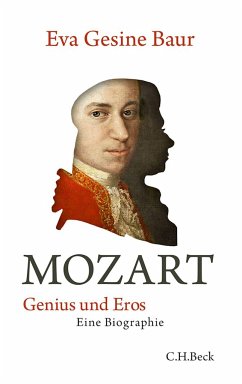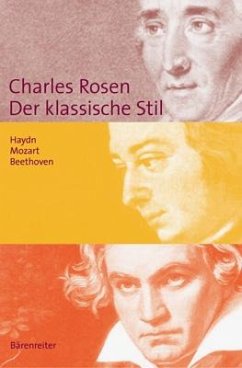Nicht lieferbar

Mozart oder Über das Schöne
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Wie zuvor in 'Johannes Brahms. Wiegenlieder meiner Schmerzen' (Lukas Verlag 1997) und 'Johann Sebastian Bach. Philosophie der Musik' (Lukas Verlag 2001) sucht der Autor auch in seinem dritten musikphilosophischen Werk nach Möglichkeiten, nachvollziehbar und begründet über Musik als Ausdruck von Gefühlen zu reden. Anders als in musikwissenschaftlichen Abhandlungen üblich, wird dabei immer von subjektiven Hörerfahrungen ausgegangen. Durch wissenschaftliche Formanalyse, aber gleichwertig auch die ausführliche Untersuchung von Tonträgereinspielungen werden sie kontrolliert. Methodische Eig...
Wie zuvor in 'Johannes Brahms. Wiegenlieder meiner Schmerzen' (Lukas Verlag 1997) und 'Johann Sebastian Bach. Philosophie der Musik' (Lukas Verlag 2001) sucht der Autor auch in seinem dritten musikphilosophischen Werk nach Möglichkeiten, nachvollziehbar und begründet über Musik als Ausdruck von Gefühlen zu reden. Anders als in musikwissenschaftlichen Abhandlungen üblich, wird dabei immer von subjektiven Hörerfahrungen ausgegangen. Durch wissenschaftliche Formanalyse, aber gleichwertig auch die ausführliche Untersuchung von Tonträgereinspielungen werden sie kontrolliert. Methodische Eigenart des Autors ist allerdings der vergleichende Blick darauf, wie in Kunst oder Philosophie mit Gefühlen umgegangen wurde. Stand für Brahms die Literatur des poetischen Realismus und für Bach die niederländische Malerei im Zentrum, so werden jetzt die Konzeptionen des Schönen untersucht, innerhalb derer sich Mozart bewegt.Vom klassischen zum romantischen Schönheitsideal, so lautet die These, bewegt sich Mozarts kompositorische Entwicklung. Das klassische Ideal wird mit Adam Smith verstanden als leicht faßlicher Ausdruck angemessener und maßvoller Gefühle. Dieses normative Kunstverständnis gerät ins Wanken in dem Maße, in dem Mozart mit Komponisten in Berührung kommt, denen es primär um Authentizität geht. Die Wiener Klassik kann deshalb als Versuch gelten, normative Richtigkeit mit expressiver Authentizität zu vereinbaren. Doch Mozarts Kraft zur Synthese ermattet, wohl aus lebensgeschichtlichen Gründen, und das klassische Ideal kehrt im Spätwerk zurück als Gegenstand der Sehnsucht. Mit Hegels Ästhetik wird erläutert, warum genau das als romantische Schönheit gelten kann. Während Hegel jedoch folgenreich die Romantik als Überwindung der Klassik dargestellt hat, läßt sich leicht zeigen, daß die europäische Kunstgeschichte vielmehr im Streit zwischen klassischem und romantischem Ideal, zwischen der Orientierung am antiken und am christlichen Erbe, ihre Besonderheit hat. Zielpunkt der Untersuchungen des Autors ist die Behauptung, daß in diesem Streit bei Mozart eine neue, moderne von Form von Schönheit entsteht, an die die klassische Moderne anknüpfen kann. Schön ist dabei, was in den vielen und disparaten Gefühlen des modernen Menschen eine temporäre und fragmentarische Ordnung herstellt.