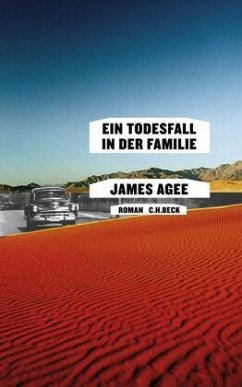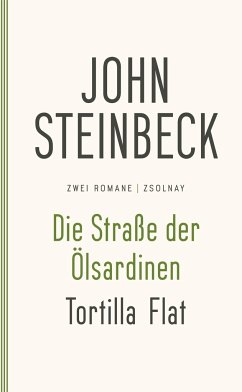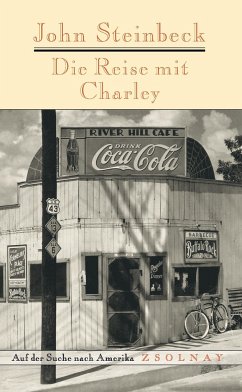international erfolgreich war auch Oksana Sabuschkos Roman "Feldstudien über ukrainischen Sex". Fast scheint es, als hätte der Deuticke-Verlag einen Marketing-Fehler begangen, als er dem Roman von Askold Melnyczuk, der im Original "What is told" heißt, einen anderen Titel gab, dabei aber ein zugkräftiges Beiwort vergaß: "Mindestens tausend ukrainische Verwandte", das wäre es gewesen.
Wir schreiben das krisenträchtige Jahr 1914. Zenon Zabobon, Gymnasialprofessor für Kunstgeschichte in einem Kaff namens Rozdorizha, lehnt es ab, Kurator im Londoner Archäologiemuseum zu werden, weil er sich in eine Bäckereigehilfin verliebt hat und befürchtet, ohne seinen beherzten Zugriff würde das Mädchen vielleicht als Bardame enden. Zenons Bruder Stefan, ein routinierter Erotomane, der gerade ein bißchen in Wien herumstudiert und diverse literarische Plänen hegt, kann es nicht fassen. So beginnt eine ukrainische Familiengeschichte, die drei Generationen umspannt und in deren Zentrum zwei sehr verschiedene Brüder stehen.
"Wer immer eines Tages unsere Geschichte erzählt, der muß die Jagd aus der Perspektive der Feldhasen erzählen", so faßt Stefan Zabobon das historisch begründete Lebensgefühl der Ukrainer zusammen. Von den gierigen Großmächten wurde das Land schikaniert und vor allem als ergiebiges Beutestück betrachtet. Nach dem Ersten Weltkrieg verleibte die Sowjetunion es sich ein, die dann bei der Kollektivierung der Landwirtschaft sieben Millionen Ukrainer planmäßig verhungern ließ. Dann kamen die Deutschen auf der Suche nach Lebensraum - für die angestammte Bevölkerung wurde er zum Todesraum. Weil man sich aber zunächst die Befreiung vom Sowjetjoch versprochen hatte, wurde es den Ukrainern ab 1944 wieder mit besonderer Bedrückungskraft auferlegt. So ist die Ukraine zum Land geworden, aus dem bis heute die Menschen auswandern, wenn sich nur die Gelegenheit bietet.
Die Kapitel der Familienhistorie illustrieren und begleiten diese ukrainische Leidensgeschichte. Stefans Ausschweifungen in Paris werden im Wechsel mit gräßlichen Episoden der Hungerkatastrophe erzählt. Zenons Neigung zum politischem Idealismus - er versteckt eine jüdische Familie vor den Deutschen - bringt ihm einen frühen, gewaltsamen Tod. Seine Frau Natalka (die Bäckereigehilfin) kann sich mit der gemeinsamen Tochter Slava in ein Lager für "Displaced Persons" retten. Dort lernt Slava ihren künftigen Mann kennen, und bald besteigt die Restfamilie das Auswandererschiff nach Amerika.
In dieses kleine Buch geht viel hinein - nicht weniger als siebenhundert Jahre ukrainische Geschichte. Was vor den Schrecken des zwanzigsten Jahrhunderts geschah, wird mythologisch integriert, durch phantastische Szenen aus dem Leben von König Toor, einem mit den Bäumen verwandten Kampfriesen, der die Tataren abwehrt und die Christianisierung der Ukraine nicht aufhalten kann. Immer wieder spukt diese Sagengestalt in den Gedanken und Träumen der Zabobons herum, die sich in direkter, wenn auch sehr langer Linie von Toor herleiten.
Askold Melnyczuk wurde als Sohn ukrainischer Auswanderer 1954 in den Vereinigten Staaten geboren. Zum ersten Mal reiste er 1991 ins Land der Vorfahren. Mit diesem Roman eignet er sich den familienbiographischen Hintergrund in literarisch verfremdeter Form an. Manche eingeschaltete Belehrung klingt dabei ein wenig schulbuchmäßig, und einige Pointen wirken nach kurzer Lustigkeitsverpuffung ein bißchen schal: "Im Krieg waren es die Generäle, an die man sich hielt; in Friedenszeiten regierten die Genitalien." Trotzdem: Man bewundert dieses Buch für seine lakonische Lebensfülle. Zumindest bis zur Auswanderung sind die Kapitel über die Familie Zabobon komprimiert wie Brühwürfel, aus denen man lange Geschichten kochen könnte.
Bis zur Hälfte liest man das Buch mit dem Gefühl, es könnte sich vielleicht zum großen Wurf auswachsen. Die Amerika-Kapitel wirken dann jedoch verwässert und leiden an faden Dialogstrecken. Während die Figuren in der ersten Hälfte sehr plastisch geschildert werden, bleiben die hinzukommenden "tausend Verwandten" im Exil blaß und unergiebig. Zwar gibt es interessante Ausführungen über die Schrecken der amerikanischen Arbeitswelt, zwar erfährt man einiges über die Art und Weise, wie Ukrainer fern der Heimat derselben gedenken. Sie treffen sich einmal im Jahr in den "Karpaten" - gemeint ist ein "ukrainisches Resort in den Catskills" -, frönen dort ausgiebig dem "Emigrantentratsch" und der Folklore. Bohdan, Sohn von Slava und Arkady, Vertreter der jüngsten Generation und in manchen Zügen wohl das Alter ego des Autors, geht brav zu den ukrainischen Pfadfindern von New Jersey.
Nur leider kommt das alles nicht mehr in Zusammenhang mit einer schlüssigen Romanhandlung daher. Jahre vergehen, und wir erleben Slava Zabobon noch als Avon-Beraterin und ihren Schwager, den einstigen Hardcore-Don-Juan als Woolworth-Rentner beim Entenfüttern. Allerhand phantasmagorische Szenen - Sterbe- und Fieberdelirien - springen vor und zurück in der Familiengeschichte. Die letzten vierzig Seiten dauern schier endlos.
Ganz am Ende hat König Toor noch einen Auftritt. Obwohl das Leben in Amerika kein Zuckerschlecken ist, setzt er in New Jersey langsam Borke an und verwandelt sich zurück in einen Baum. Wer jetzt keine Wurzeln schlägt, hat keine mehr. Der Leser aber ist nicht gerührt, sondern froh, daß es vorbei ist. Schade um ein Buch, das so vielversprechend begonnen hat.
Askold Melnyczuk: "Mindestens tausend Verwandte". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Martin Amanshauser. Deuticke Verlag, Wien 2006. 208 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
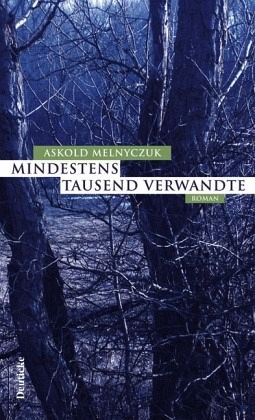





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2006