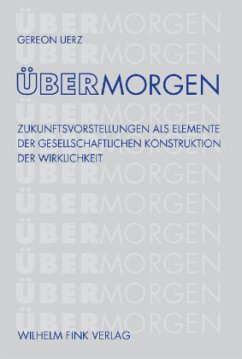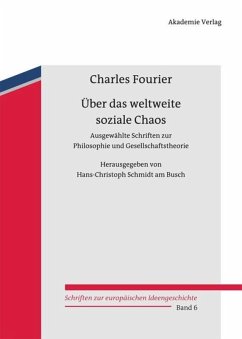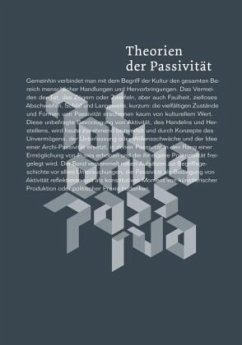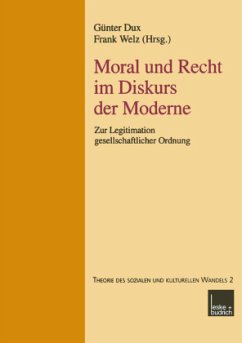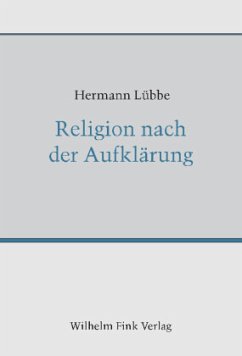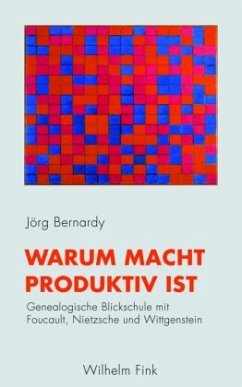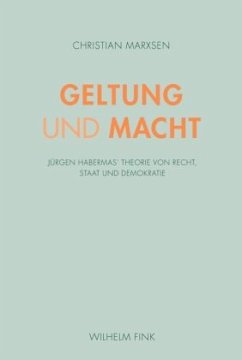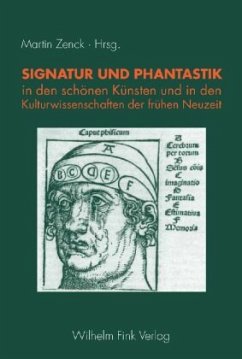Metaphern der Gesellschaft
Studien zum soziologischen und politischen Imaginären
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
56,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gegenstand des Bandes sind rhetorische Strategien, speziell Gesellschaftsmetaphoriken in soziologischen und sozialphilosophischen Texten. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Metaphern der Gesellschaft als Organismus und als Vertragsverhältnis ('Gesellschaftsvertrag'), deren Antagonismus sich von der griechischen Antike bis in die jüngsten Verzweigungen der Kommunitarismusdebatte verfolgen läßt. Im Hauptteil werden Schlüsseltexte der sozialphilosophischen (Platon, Aristoteles, Paulus, Hobbes) und soziologischen (Durkheim, Tönnies) Überlieferung daraufhin untersucht, wie die genann...
Gegenstand des Bandes sind rhetorische Strategien, speziell Gesellschaftsmetaphoriken in soziologischen und sozialphilosophischen Texten. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Metaphern der Gesellschaft als Organismus und als Vertragsverhältnis ('Gesellschaftsvertrag'), deren Antagonismus sich von der griechischen Antike bis in die jüngsten Verzweigungen der Kommunitarismusdebatte verfolgen läßt. Im Hauptteil werden Schlüsseltexte der sozialphilosophischen (Platon, Aristoteles, Paulus, Hobbes) und soziologischen (Durkheim, Tönnies) Überlieferung daraufhin untersucht, wie die genannten Leitmetaphern das durch sie konnotierte Bild der Gesellschaft produktions- und rezeptionsästhetisch modellieren. Vorbereitet wird dieser historische Längsschnitt durch einen einleitenden wissenschaftstheoretischen Teil, der figuratives Sprechen als ebenso ideologisches wie irreduzibles Element gesellschaftstheoretischer Texte nachweist und damit einen Begriff des sozialen Imaginären exponiert, den die Lektüren des Hauptteils exemplifizieren. Den Abschluß des Bandes bilden 'Meditationen zur Biopolitik'.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.