und aufdeckenden ("apokalyptischen") Christologie. Die Rede vom "leidenden Gott" ist, jedenfalls als Begriffsfixierung, keineswegs eine Beruhigung des Gottsuchers. Das menschliche Leiden auf Gott zu projizieren bedeute, entweder das Leiden zu verdoppeln, ohne Rettung zu gewinnen, oder aber das Leiden selbst nicht recht ernst zu nehmen. Kein anderer leidet meinen Schmerz, stirbt meinen Tod - auch der Sohn Gottes nicht.
Aus einer Theologie, die den "Gottesbegriff nach Auschwitz" (Hans Jonas) zu retten versucht, entsteht eine Theologie der "Compassion", die einerseits das Leiden an Gott, und das heißt: an seiner Abwesenheit im menschlichen Leid, nicht verschweigt, sondern herausschreit, und die andererseits in der, wie es in der theologischen Sprache heißt, Nachfolge Christi eine existentielle Befriedung findet. Der Intellekt hätte demnach nachzuvollziehen, daß in dem menschlichen Schrei der Gottverlassenheit - "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" - Gott doch präsent ist. Der Schrei geht nicht ins Leere, so wird postuliert. Arme Theologie, schwacher Trost.
Das ist Metz sehr wohl bewußt: Theologie ist für ihn eine "arme Wissenschaft", keine allwissende Kulturtheorie. Und die Antworten dieser armen Theologie sind weniger Problemlösungen als brennende Fragen an den biblischen Gott. Es geht der Theologie der "Compassion" aber gar nicht primär um den eigenen Seelenfrieden, um die Erschließung von Religion als "Kontingenzbewältigung", sondern um den anderen und sein Leiden.
Wie um die beiden Brennpunkte einer Ellipse kreisen die Aufsätze des vorliegenden Sammelbandes um die Denkbarkeit der Theodizee. Aus der Überarbeitung früherer Beiträge und Vorlesungen (zum Teil zusammen mit dem Wiener Fundamentaltheologen Johann Reikerstorfer) entstanden, bilden sie so etwas wie eine - eher thetische als deduktive - Apologie der von Johann Baptist Metz seit mehr als drei Jahrzehnten vertretenen "neuen politischen Theologie". Guter alter Linkskatholizismus aus dem Geist des Konzils.
Es handelt sich um eine Apologie, die mehr als einmal zur Polemik übergeht. Metz ist gegen theologische Entwürfe, die ihre intellektuelle Würde aus der Distanz zum bloß Subjektiven und zum Engagement gewinnen wollen. In den Tagebüchern Kierkegaards findet Metz einen Kommentar zu dem von ihm Gemeinten: "Es geht den meisten Systematikern in ihrem Verhältnis zu ihren Systemen wie einem Mann, der ein ungeheures Schloß baut und selbst daneben in einer Scheune wohnt. Sie leben nicht selber in dem ungeheuren systematischen Gebäude. Aber in geistigen Verhältnissen ist und bleibt das ein entscheidender Einwand". Lehre und Leben gehören zusammen, in der Theologie wie in den anderen Geisteswissenschaften, die Metz in der Versuchung sieht, sich in "subalterne Naturwissenschaften und Technologien" zu verwandeln. In der Wolke der theologischen Zeugen leuchten neben Kierkegaard Augustin, Pascal, Newman, Bonhoeffer, vor allem aber der eigene Lehrer, Karl Rahner.
Ausdrücklich wird der Vorwurf, wenn Metz Theologie und Kirche Tendenzen zur "Selbstzensur" beziehungsweise zur "Selbstprivatisierung" bescheinigt, die um der Anpassung an den Zeitgeist und den Zeitmythos willen wichtige Teile ihrer Botschaft umdeuten oder gar nicht mehr erwähnen: Naherwartung und Wiederkunft Christi. Metz spricht von der notwendigen Apokalyptik der Theologie. Es gehe "darum, die Wiederkunftslehre als Lehre von der Befristung der Zeit zu begreifen". Diese Theologie kennt Sehnen und Hoffnung.
Zu wehren sei Versuchen, sich dem Mythos der endlosen Zeit anzugleichen, der das Ende der Welt nur mehr zeitlos zu denken vermag oder auf die individuelle Lebenszeit einschränkt. Metz sieht die fatalen Konsequenzen einer solchen Entgrenzung der Zeit: eine Lebenshaltung der Unverbindlichkeit, die scheinbar unbegrenzte Revidierbarkeit des eigenen Tuns, die spielerische, oft narzißtische, kulturell und ethisch unernste Wahl von Lebensentwürfen. Aber auch Phänomene der Beschleunigung und Mobilisierung, die für Metz "richtungslose Turbulenzen" des modernen Nomaden sind, der "Angst vor der Angst" habe. Geht es nicht eher darum, worum es ganz unheroisch immer ging: um Flucht vor dem Tod?
Der zeitlosen Rastlosigkeit entspreche eine Art der (auch religiösen) Rede: die Wiederbelebung des Mythos, die Affirmation der ewigen Wiederkehr, Geschichtsmüdigkeit, Melancholie und ethische Indifferenz. Das von Metz ausgestellte Rezept dagegen ist eine Verbindung von Logos und Erzählung, "anamnetische Vernunft", welche die wissenschaftlich-historische Rekonstruktion des Vergangenen ergänzt.
Der Autor plädiert ausdrücklich nicht für ein postmodernes Identifikationsangebot in Gestalt einer Vielzahl fiktionaler Erzählungen. Doch wird die Abgrenzung vom Mythos unabsichtlich unscharf, wenn Metz die Gründungserzählungen des Christentums als "historisch durchwachsene Erzählungen" beschreibt. Wie verläßlich sind solche Erzählungen? Wie wollen sie gelesen werden? Wenn man wie Metz Geschichte als Großerzählung menschlichen Leids konzipiert, beinhaltet dies nicht notwendig ein Konzept auch von Heilsgeschichte, von Inkarnation und Offenbarung? Besteht sonst nicht die Gefahr, daß Geschichte sich wieder in "Geschichtlichkeit" verflüchtigt?
Wer von Gott redet, muß vom Menschen reden. Eine Theologie der "Compassion" erzwingt das anthropologische Nachdenken. Denn will sie an ihr praktisches Ziel kommen, muß sie zu verstehen suchen, warum die Wahrnehmung fremden Leids keineswegs zwangsläufig zu Versuchen führt, es zu beseitigen. Es liegt in der Konsequenz der hier vorgestellten Theodizee, daß ihr eine ebenso offene "Anthropodizee" entspricht: "Das Christentum sieht den Menschen als schuldfähig an. Die Zumutung der Schuld an den Menschen ist die Zumutung der Freiheit und der Verantwortung." So hat die Stellung des Menschen vor Gott wesentlich mit dem Handeln zu tun. Es spricht viel anthropologischer Optimismus aus der Annahme, solche Einsicht führe zu besserem Handeln und zu einer besseren Welt.
Für denjenigen, der noch oder wieder ernsthaft auf der Suche nach Gott ist, sind Metz' im Manifeststil vorgetragene Antworten vielleicht ungewohnte, aber weiter führende theologische Anregungen aus dem Geist biblischer Tradition. Sie umreißen eine Theologie aus dem Herzen, keineswegs bloß aus dem Bauchgefühl. Sie bezeugen glaubhaft, daß für den Verfasser "politische Theologie" im Grunde ein Pleonasmus ist. Welches Wort von beiden ist überflüssig?
Für denjenigen aber, dem es primär um die Lösung praktischer Aufgaben geht, die sich aus der Beobachtung fremden Leids ergeben, könnte die Theologie der "Compassion" als Weg um die Mühen der politischen Ebene herum erscheinen. Der Gottesgedanke, den Metz zu denken beansprucht, ist dialektisch und pragmatisch nicht zwingend. Das heißt aber nicht, daß er nicht geschichtlich wahr sein könnte.
HERMUT LÖHR
Johann Baptist Metz: "Memoria Passionis". Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. Herder Verlag, Freiburg 2006. 288 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




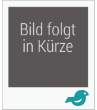


 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2006