unterschiedlichsten Regime in Deutschland gleichermaßen die öffentliche Existenz aberkannten und die heute noch vielleicht siebzigtausend Menschen als ihre Muttersprache empfinden.
Die Sorben sind schon oft totgesagt worden, und es gibt sie immer noch. Um das Jahr 500 nach Christus sind sie in ein Gebiet eingewandert, das später von germanischen Stämmen besiedelt und dem karolingischen Reich einverleibt wurde. Abwechselnd mit Versprechungen und Verfolgungen wurden die Sorben seither staatlich davon zu überzeugen gesucht, daß es für sie besser wäre, sich der deutschen Umwelt zwischen Bautzen und Cottbus als Deutsche zu assimilieren. Wie sie es zuwege brachten, sich unter dem steten Einfluß deutscher Kultur die eigene Sprache wider Zwang wie Lockung der Assimilation zu bewahren, das mutet geradezu rätselhaft an.
Im Jahr 1916, als der Kaiser im Krieg keine Parteien, nur noch Deutsche kennen wollte, mochte er auf deutschem Boden auch keine slawische Minderheit mehr anerkennen; damals kehrten die Eltern von Jurij Brezan, die ihren Sohn ins Geburtsregister eintragen lassen wollten, mit der Anweisung nach Hause, ihr Kind habe von Amts wegen auf den Namen "Georg Wend" zu hören. Weil er es "seinem Enkel versprochen hatte", macht sich dieser Georg Wend, aus dem später der von den Eltern erwünschte Jurij Brezan wurde, mit achtzig Jahren daran, seinen weiten Lebensweg in der Erinnerung noch einmal zu gehen und aufzuschreiben, was er als "mein Stück Zeit" erlebt hatte.
Der Rahmen, den er dafür wählte, ist noch aus den Materialien der alten DDR gezimmert, in denen die Sorben all den Unwägbarkeiten ausgesetzt waren, mit denen der reale Sozialismus seine Schutzbefohlenen mittels regelmäßiger Parteitagsbeschlüsse überraschte: Bald als kleines Brudervolk der großen slawischen Brüdervölker des ersten deutschen Arbeiterund-Bauern-Staates gefördert, bald administrativ reglementiert, waren die Sorben in der DDR vor allem dann wohlgelitten, wenn sie die Toleranz des Systems durch Auftritte eines harmlosen Folklorismus erwiesen. Auf dieses prekäre Verhältnis der Sorben zur Staatsmacht verweist der erzählerische Rahmen von Brezans Erinnerungen: Ein alter Mann sucht am Bahnhof eine Fahrkarte in die Stadt "Olim" zu erstehen, die "bahnamtlich Einst" heißt, doch der Vorstand des Provinzbahnhofs verweigert die Reise, weil ein Schriftsteller nicht zu den privilegierten Berufsgruppen gehört, denen er Einsicht in die Akten von gestern zugestehen kann.
Die hübsche kleine Bürokratie-Satire führt den Autobiographen mitten hinein in ein Leben, in dem er sich nacheinander als Lehrer, Dichter, illegaler Kämpfer und geschaßter Kulturfunktionär zu bewähren hatte und doch stets in den nämlichen Widerstreit mit der Obrigkeit geriet. Im Dritten Reich war er mehrmals verhaftet und einmal sogar vom SS-Führer Heydrich höchstpersönlich verhört worden. Die Nationalsozialisten hatten, wie man heute weiß, für die Zeit nach dem Krieg eine endgültige Lösung der Sorbenfrage durch Deportation der arbeitsfähigen Männer geplant, und mehr als einmal ist Brezan, ein Aktivist des national-sorbischen Widerstands, dem Tod wohl nur knapp entronnen.
In der DDR wird Brezan anfangs umworben, bald aber schon als "Nationalist" gebrandmarkt und für drei Jahrzehnte auf die Schaukel von öffentlicher Verurteilung und nachfolgender Rehabilitierung, von Ächtung und Ehrung gesetzt. Was ihm in der DDR widerfuhr und wie den Sorben ihr Siedlungsgebiet durch eine forcierte Industrialisierung, Marke Ulbricht, zerstört wurde, davon erzählt Brezan mit grimmigem Spott, aber doch wie nebenhin. Gerade fünfzig Seiten nur wendet er für die fünfzig Jahre seit 1945 auf, 250 Seiten von "Mein Stück Zeit" aber widmet er seinen ersten dreißig Lebensjahren, in denen die Sorben vor die nationale Überlebensfrage gestellt wurden.
Warum bleibt einer ein Sorbe, wo doch der Name des eigenen Volkes, als Schimpfwort der Deutschen gebraucht, "wie weggeworfenes Lumpentuch" klingt? Der Achtzigjährige, wenn er die Antwort sucht, erinnert sich an die eigene Mutter, die für ihren Sohn nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch, sondern auch ein Buch war: "Magd für Vieh und Feld und Haus und Hof und Tausendseitenbuch mit Geschichten, fernen, fremden, unseren; die Geschichten rissen die Zeiten auf, und die Zeit war ein Fluß, ahnbar Quelle und Mündung, und Träume hatten tiefe Wurzeln."
Im einprägsamen Bild von den Träumen, die tief in den sorbischen Liedern, den Geschichten der Mutter wurzeln, ist die Entwicklung zum Künstler vorweggenommen, der sich die Sprache als Wurzelgrund seiner Phantasie und seines Weltvertrauens nicht rauben lassen möchte. Brezan hat stets sorbisch und deutsch geschrieben, er war an "Deutschland mehr als nur gebunden: eingewachsen, verwachsen und keine Loslösung möglich, es sei denn, ich zerschnitte mich selbst". Gerade der Faschismus aber, der ihm die Entscheidung für die eine und gegen die andere Sprache abverlangte, hat aus ihm einen flammenden Verfechter der Muttersprache gemacht. Eben noch selbst ein eher unwilliger Schüler des Sorbischen, wurde er 1937, nachdem jedwede sorbische Kulturarbeit verboten war, denen ein Lehrer der verpönten Sprache, die sich der Gleichschaltung widersetzen wollten.
Brezan bannt die großen Stationen des Lebens in den kleinen Entscheidungen des Tages, er faßt sein Jahrhundert an einem scheinbar abseitigen Schauplatz. "Alles, was sich hier bei uns abspielte, geschah schon für den ,Mann von der Straße' in Dresden ganz am Rande, außerhalb seines Gesichtskreises, irgendwo hinter sieben Bergen, bei den sieben Zwergen." Und doch gibt es in Europa keine andere Geschichte als die, an der auch die Sorben ihren Anteil haben, mit allem, was sie erleiden und was sie dem zähen, für sie oft so ungünstigen Gang der Ereignisse entgegenzusetzen wissen. Und Jurij Brezan, weltoffen, verschmitzt, unbeirrt, ist einer ihrer großen Chronisten.
Jurij Brezan: "Mein Stück Zeit". Roman. Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig 1998. 298 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
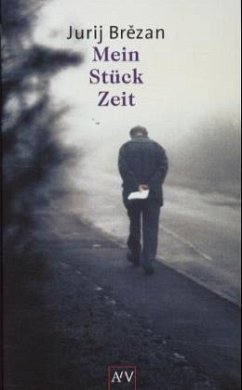




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.07.1998