Epochen sind nicht säuberlich zu trennen, sondern ineinander verwirkt. Delius geht deshalb nicht chronologisch vor. Er führt die einzelnen Abschnitte parallel und zeigt darin die Macht des Verdrängten, die unerlöste Gegenwart der Geschichte in jedem Augenblick.
"Mein Jahr als Mörder" ist ein Buch über Deutschland im zwanzigsten Jahrhundert. Es beginnt im Jahr 1968. Der Ich-Erzähler war damals Literaturstudent in West-Berlin. Aus den Nachrichten des Rias erfährt er, Hans-Joachim Rehse, einst Richter am nationalsozialistischen Volksgerichtshof unter Freisler, sei freigesprochen worden. Spontan beschließt er, diesen Mann zu ermorden. Denn Rehse hat den Vater seines besten Freundes Axel auf dem Gewissen, mit dem zusammen er die Nachkriegssommer der Kindheit in Wehrda verbrachte. Dieser unbekannte Vater, Georg Groscurth, war zusammen mit Robert Havemann führender Kopf der Widerstandsgruppe "Europäische Union". Ende 1943 wurde er verhaftet, von Rehse zum Tode verurteilt, im Mai 1944 in Brandenburg-Görden mit dem Fallbeil hingerichtet. "Kopf abgehackt" heißt das Kapitel, in dem der Junge davon erfährt und sich dieses Kopfabhacken so vorstellt, wie er es vom Schlachten von Hühnern kennt.
Sein Mord- und Racheplan führt mitten hinein ins Jahr 1968. Gewalt ist in dieser Zeit kein abwegiger Gedanke. Martin Luther King und Robert Kennedy wurden ermordet, Rudi Dutschke niedergeschossen, es gab Massaker in Vietnam und Mexiko, einen Aufstand in Paris und russische Panzer in Prag. Da wurde, mit einer Parole der Studenten, "Widerstand zur Pflicht". Konkrete politische Handlungen waren gefragt; alle Theorie mußte in Aktion münden, und auch die Literatur bewies ihren Wert erst in der Handlungskonsequenz. Delius' Erzähler beginnt nun mit Recherchen über den Richter R. und vor allem über Georg Groscurth. Er will gewissermaßen das Buch zur Tat schreiben. Es soll erscheinen, nachdem er seinen guten und gerechten Mord begangen haben wird. So stellt er sich das perfekte Marketing vor.
Mein Jahr als Mörder" ist eine spannende Dokumentation. Man sollte den Text weniger als Roman denn als Sachbuch lesen, damit der brisante Stoff nicht im Reich der Fiktionen neutralisiert wird. Delius, mit Groscurths Söhnen von klein auf befreundet, hat dafür zahlreiche Gespräche geführt, Aktenmaterial und Briefe gesichtet, die Autobiographie des Verlegers Hermann Kindler gelesen, der in der "Europäischen Union" mitarbeitete, und aus Ruth Andreas-Friedrichs Tagebuch "Der Schattenmann" den Bericht eines Augenzeugen über die Hinrichtung zitiert. Die Romanhandlung ist gegenüber dem Faktenmaterial fast nebensächlich.
Georg Groscurth arbeitete als Arzt im Berliner Robert-Koch-Krankenhaus. Weil jüdische Ärzte dort nach 1933 entlassen und durch SA- und SS-Ärzte ersetzt wurden, war er einer der wenigen kompetenten Mediziner. Führerstellvertreter Rudolf Heß vertraute ihm, machte ihn sogar zu seinem Leibarzt. Im Schutz dieses Verhältnisses konnte Groscurth zusammen mit dem Chemiker Robert Havemann, dem Dentisten Paul Rentsch und dem Architekten Herbert Richter und rund zwanzig anderen die "Europäische Union" aufbauen. Sie halfen Zwangsarbeitern und Menschen in der Illegalität, arbeiteten mit Tschechen, Slowaken, Polen, Russen zusammen, versteckten Juden, versorgten sie mit Lebensmitteln.
Groscurth wollte praktische Hilfe leisten. Delius zeichnet ihn als tätigen Humanisten ohne konkrete politische Ziele, der in der Zeit der Barbarei durchhalten wollte bis zum Ende des Krieges und der nationalsozialistischen Herrschaft. Anders Robert Havemann, der nicht gut wegkommt: Er suchte Kontakt zu den Sowjets, druckte mit großem Risiko Flugblätter, gefährdete aus "Ehrgeiz und Eitelkeit" die Gruppe und machte sich dadurch mitschuldig am Tod der Freunde. Havemann war der einzige, dessen Todesurteil nicht vollstreckt wurde, weil es ihm gelang, die kriegsentscheidende Bedeutung seiner Forschung glaubhaft zu machen. Der weitere Lebensweg Havemanns nach dem Krieg, vom überzeugten Stalinisten zum führenden Dissidenten der DDR, ist bekannt.
Vergessen dagegen ist das Schicksal von Anneliese Groscurth, der Witwe des hingerichteten Arztes, die selbst in der "Europäischen Union" mitarbeitete. Sie ist die eigentliche Heldin des Buches, ihr gilt alle Sympathie. Ein ums andere Mal schärft sie dem Ich-Erzähler ein: "Es gab keine Helden." Es gab bloß "ein paar anständige Leute". Mit wenigen Prinzipien kommt sie aus: Sie ist für den Frieden, gegen Remilitarisierung, gegen Nazis. Damit aber, und politisch eher naiv, gerät sie in Widerspruch zur bundesdeutschen Restauration unter Adenauer. In ihrer Wohnung findet 1951 die Pressekonferenz einer "Volksbefragung" gegen die Wiederbewaffnung statt. Der West-Berliner "Tagesspiegel" machte daraus eine "kommunistische Volksbefragung" und entschied mit der Hinzufügung des Wörtchens "kommunistisch" ihr Schicksal für Jahrzehnte. Anneliese Groscurth galt in West-Berlin daraufhin als Parteigängerin der DDR und wurde wie eine Hexe verfolgt. In dieser irrsinnigen Zeit galt der Satz: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Im Kalten Krieg gerieten ausgerechnet die Menschen in Verdacht, die schon den Nazis verdächtig waren.
Anneliese Groscurth wurde an den Pranger gestellt. Sie verlor ihren Rentenanspruch als Verfolgte des Naziregimes, während gleichzeitig alle ehemaligen NS-Beamten ihre Rente rückwirkend beanspruchen durften und eine Beschäftigungsgarantie erhielten. Sie verlor ihren Job als Bezirksärztin und fand eine Stelle nur noch beim "Berliner Rundfunk" in der Masurenallee - einer DDR-Institution im Westen. Nach dem Mauerbau zog der Sender nach Ost-Berlin um. Sie wohnte weiter im Westen und arbeitete nun im Osten: Ausdruck ihrer Stellung zwischen den Machtblöcken. Einen Reisepaß verweigerten ihr die Behörden mit der atemraubenden Begründung, sie agitiere gegen die freiheitliche Grundordnung. Ein unsinniger Vorwurf. Sie mußte prozessieren und verlor erneut. Zwanzig Jahre dauerte der zähe Kampf mit den Gerichten, die wie eine vielköpfige Hydra gegen sie agierten. Delius berichtet, unter welch fragwürdigen Bedingungen der bundesdeutsche Rechtsstaat seine Arbeit aufnahm. Wie gründlich die Grenze zur ideologischen Urteilsbegründung überschritten wurde. Wie eine Humanistin zur Staatsfeindin gemacht wurde. Erschreckend deutlich wird die Kontinuität zu Gerichten des Dritten Reiches. Ein Rechtsstaat fällt eben nicht vom Himmel.
Die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit hat nach 1989 in Vergessenheit geraten lassen, daß es auch im Westen politisch motivierte Rechtsbeugung gab. Hätte sich diese Geschichte in der DDR ereignet, würden wir Anneliese Groscurth heute als Dissidentin bezeichnen. Es ist das Verdienst von Delius, an die Ursprünge der Bundesrepublik zu erinnern und damit auch die Achtundsechziger-Generation in ihrem Gerechtigkeitsdrang und ihrer Wut gegen die Verdrängung des nationalsozialistischen Erbes ein wenig zu rehabilitieren. Er zeigt aber auch die absurde Ideologisierung der Studenten, ihre Kleingruppenfraktionierung und ihren Wahrheitswahn, ihre Militanz und ihren gnadenlosen Gruppenzwang.
Indem er den Bericht seines doch eher braven Ich-Erzählers - der natürlich auch den geplanten Mord niemals ausführt - als "Beichte" bezeichnet, gibt er dem gegenwärtig herrschenden, den Achtundsechzigern gegenüber kritischen Zeitgeist jedoch etwas zu stark nach. Bei aller Kritik an einstigen "Jugendsünden": Muß man auch die Ernsthaftigkeit, mit der damals gedacht und gehandelt wurde, diskreditieren? Ist der Ernst der Lebensführung und des politischen Wollens nicht vielmehr eine Qualität, die verlorenging und nach der man sich im postironischen Zeitalter des Pragmatismus schon wieder zu sehnen beginnt? Schließlich ist es doch gerade die ernste Entschlossenheit der Recherche, die "Mein Jahr als Mörder" auszeichnet.
Friedrich Christian Delius: "Mein Jahr als Mörder". Roman. Verlag Rowohlt Berlin, Berlin 2004. 304 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
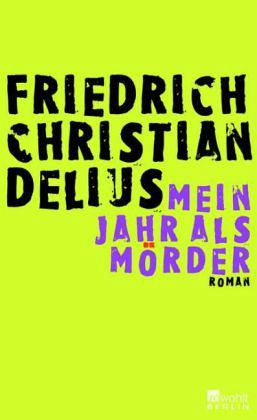





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.2004