Vorgängern, mit denen er sich immer wieder auseinandersetzt - kritisch mit dem Landsmann Sieburg, zustimmend mit dem Schweizer Lüthy -, schrieb Harpprecht sein Buch in Frankreich selbst, wo er seit fast zwanzig Jahren lebt. Die Kleinstadt am Mittelmeer, die der Autor hinter dem freundlichen Namen "Port Madeleine" verbirgt, diente ihm schon früher als Kulisse für Dorfgeschichten aus dem Midi. Dort hat der Schwabe Harpprecht seine Kenntnis von Land und Leuten erworben, dort durfte die "schwierige Liebe" Wurzeln schlagen. Wie in anderen Teilen der "France profonde", ein Begriff, den die Einheimischen selten oder nie, Politiker und Journalisten um so häufiger im Munde führen, kann man auch in "Port Madeleine" die Erfahrung machen, wie gut es sich fern von Paris, ja ohne Paris lebt.
Aber es geht nicht um "Land und Leute", jedenfalls nicht vorherrschend, es geht um Frankreich, um Frankreich und Deutschland, um Europa, um unser Verhältnis zur Welt. Sieburg und Lüthy machten die These vom Modernitätsabstand zwischen den beiden Nachbarländern zum Kern ihrer Darstellung, in einer Zeit, da Frankreich noch weitgehend agrarisch, Deutschland eindeutig industriell geprägt war. Das hat sich gegeben. Mit der Nutzung der Kernenergie und anderen technischen Hochleistungen rückte Frankreich in die Spitzengruppe der Industriestaaten auf. Beim Festhalten am sozialen Besitzstand zeigen sich die Deutschen nicht weniger veränderungsscheu als die Franzosen. Die beiden Länder werden einander ähnlicher, so die beruhigende These Harpprechts, oder um es mit einem Paradox zu sagen: "Frankreich ist in den letzten Jahrzehnten ein wenig deutscher und Deutschland ein wenig französischer geworden." Frühere Autoren auf diesem Feld erzielten die brillantesten Wirkungen beim Spiel mit Stereotypen. Harpprecht weiß, daß das nicht länger möglich ist, weil die Vorurteile der Wirklichkeit nicht mehr entsprechen, wenn sie ihr je entsprochen haben, und mehr noch, weil aus dem Spiel tödlicher Ernst werden kann. So ist die Darstellung "Mein Frankreich" auch ein Abschied von den Mythen, die das nationale Selbstverständnis und das Bild des anderen geprägt haben. Die Standortbestimmung des Frankreich unserer Tage, die Harpprecht gibt, zeigt die Nation in einem Übergangsstadium: "Es ist, als verharre die Gesellschaft in einer Art Niemandsland zwischen den Epochen. Die Nation weiß, daß sie sich selber nicht mehr genügt, wie sie es so lange getan hat."
Eine Lektion für den deutschen Leser bedeutet es, wenn der selbstgefälligen Vorstellung von einer "exception française", über die sich die anderen oft belustigen und gelegentlich ärgern, die Vorstellung von einem deutschen "Sonderweg" entgegengehalten wird, die ganz anderen Sprengstoff birgt. Harpprecht steht nicht in der Versuchung, das klarer akzentuierte Nationalgefühl der Franzosen seinen Landsleuten als nachahmenswertes Beispiel vorzuhalten. Der einstige Berater des Bundeskanzlers Brandt weiß, was er an der bescheidenen "Bonner Republik" hatte, von der selbstbewußteren "Berliner Republik" weiß er das noch nicht. Er freut sich, wenn in seiner Kleinstadt junge Soldaten der Bundeswehr in Uniform über den Markt schlendern, die in der Gegend stationiert sind, und er ist sich bewußt, wie wenig selbstverständlich diese Präsenz ist.
Die Zukunft, das macht Harpprecht bei der Bestandsaufnahme der Gegenwart deutlich, liegt für beide Länder in Europa als einer sinnvollen Größenordnung in der globalen Gesellschaft. Die "Einbindung" gilt nicht nur für Deutschland, sie gilt auch für Frankreich und alle anderen Partner. "Durch Europa hebt sich die Antithese ,Nation - Welt' endlich auf", erkennt der Essayist hoffnungsvoll. Das gilt besonders für das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, denen sich Harpprecht als langjähriger Korrespondent in Washington verbunden fühlt: "Europa kann nicht antiamerikanisch sein, wenn es seine Einheit nicht aufs Spiel setzen will."
An Weltkenntnis und Weltverständnis, bemängelt der Weltbürger Harpprecht, fehle es Franzosen wie Deutschen, ersteren vielleicht ein bißchen mehr. Dazu mag die selbstbezogene Art der Pariser Eliteausbildung an den "grandes écoles" beitragen, eine besonders wirksame Form geistiger Inzucht. Aber wir erinnern uns auch, daß beim Fall der Mauer im November 1989 Zöglinge der "Sciences-Po" und der ENA nach Berlin eilten, um bei dem historischen Ereignis dabeizusein.
Zwei weiße Flecken fallen in diesem an guten Beobachtungen und Überlegungen so reichen Frankreich-Buch auf: Bei der Darstellung des Zentralismus und der Dezentralisierung fehlt der Hinweis auf die Korruption, wie sie sich im Gefolge der Entscheidungsdelegation an Départements und Gemeinden entwickelt hat. Die Immigration, eines der ernstesten Probleme der französischen Gesellschaft, wird nur gestreift. Aber der Zuzug aus der "dritten Welt", im Fall Frankreichs aus Nord- und Schwarzafrika, läßt sich nicht auf Fragen der Menschenrechte oder des Staatsangehörigkeitsrechts reduzieren, verbunden mit der Hoffnung auf eine Integration in der dritten Generation. Für die Korruption wie für die Immigration, so glauben wir zu wissen, gibt es im Umkreis von "Port Madeleine" genügend Anschauungsmaterial.
THANKMAR VON MÜNCHHAUSEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
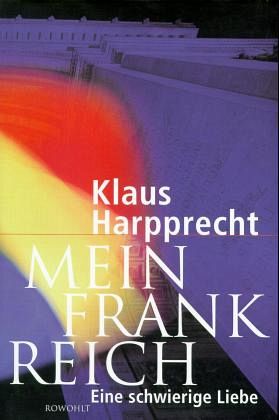




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.05.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.05.1999