Kants "Kritiken" ohne die entstehende Öffentlichkeit im späten achtzehnten Jahrhundert nie geschrieben worden. Ohne "Medien" und "Kommunikation", so Hartmann, ist Philosophie buchstäblich undenkbar.
Ob ein Denken jenseits von Sprache möglich ist, gehört zu den grundlegenden Fragen der Sprachphilosophie vom achtzehnten Jahrhundert bis heute. Hartmann bietet hier eine einfache Antwort: Ja, es ist. Schon Humboldt, Herder und Hamann hätten das Problem erkannt - der Romancier, Journalist und Sprachkritiker Fritz Mauthner habe dann zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Sprache als Erkenntnismedium in Frage gestellt. So unterschiedliche Denkansätze wie Charles S. Peirces Semiotik, Gotthold Freges Logik und Otto Neuraths Bildsprache interpretierte Hartmann als Versuche, die Vorherrschaft der alphanumerischen Sprache über das Denken zu überwinden.
Die ersten Philosophen im Medienzeitalter reagierten auf die Informationsmaschinen mit einem "Rückzuggefecht": Über Edmund Husserl führt der Weg zu Martin Heidegger, dem der Autor zwar zugesteht, er habe "der Sprache einige Aufmerksamkeit gewidmet", dem er allerdings auch einen "aristokratischen, jedenfalls elitären Blick auf die Entwicklungen der Moderne" attestiert. Das ist der Einsatzpunkt der "Medienphilosophie". Sie will jedenfalls nicht elitär sein. Ihre grundlegende Erkenntnis ist, dass nicht nur Sprache, sondern Medien generell Wirklichkeit konstruieren, dass es gar kein Außerhalb von Medialität mehr gibt.
Der Unterschied zwischen Realität und Repräsentation werde hinfällig, da der Mensch die Wirklichkeit gar nicht mehr als Wirklichkeit erfahre, sondern nur in ihrer Repräsentation. "Reale Virtualität" nennt Hartmann diese Konzeption. Ob es nun um das "Ende der Gutenberg-Galaxie", "The medium is the message" oder die "neuen, nicht-linearen Navigationsstrukturen" geht - was Hartmann als "Theoreme" der Medienphilosophie und ihre Meisterdenker Harold Innis, Marshal McLuhan und Vilém Flusser anführt, geht über Gemeinplätze kaum hinaus. Problematisch ist, dass Hartmann, der sich den Klassikern kritisch genähert hat, nun Aussagen wie das Postulat, man müsse "über Sprache projektiv hinausdenken", oder Flussers Rede vom "kosmischen Stil" unbefragt zitiert. Und manches, was der Autor als Medienphilosophie präsentiert, ist eher Medientheologie.
"Synthetisierende Theorien mit umfassendem Erklärungsanspruch, die zwischen zwei Buchdeckeln präsentiert werden, verlieren zunehmend an Glaubwürdigkeit", verkündet Frank Hartmann bereits in der Einleitung. Doch "Medienphilosophie" - erschienen in der akademischen UTB-Reihe - ist selbst eine Art Lehrbuch mit Zusammenfassungen jeweils am Kapitelende und mit Übersichtstafeln. Der Autor ergänzt seinen Text mit fünfundzwanzig schlecht reproduzierten und unkommentierten Abbildungen, die wohl kaum das "bildliche Philosophieren" lehren können, das er als Ausweg aus der Sprachbefangenheit sieht. Und so bietet "Medienphilosophie" - ein Buch, das außen als Lehrbuch daherkommt und innen das Ende der Lehrbücher verkündet - sich weniger als Seminarlektüre an als vielmehr als Small-Talk-Munition.
NINA DIEZEMANN
Frank Hartmann: "Medienphilosophie". WUV, Wien 2000. 343 S., br., 39,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
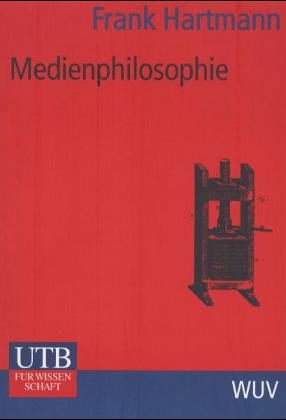




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.05.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.05.2000