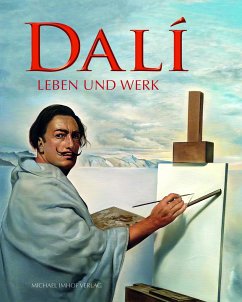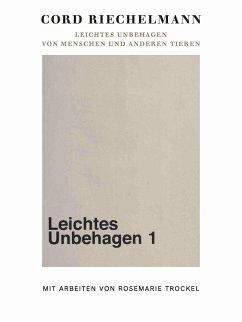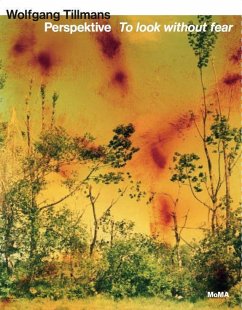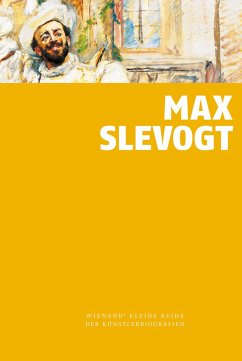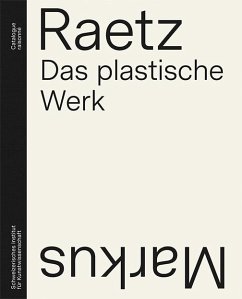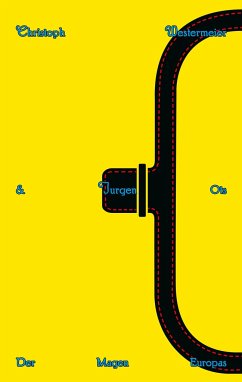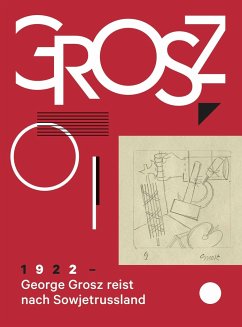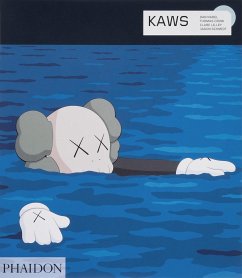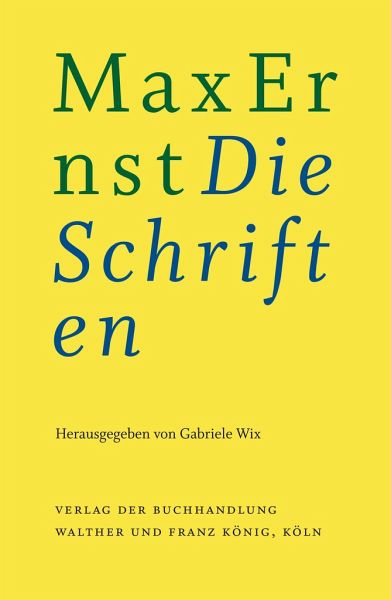
Max Ernst: Die Schriften
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
48,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"schön scheint die lampe im mond" - ein Satz des bildenden Künstlers Max Ernst, der zeitlebens geschrieben hat und dessen literarisches Werk jetzt erstmals umfassend in deutscher Sprache zugänglich ist. Ob Gedicht, Kurzprosa, Roman oder Theaterstück, Kunst- und Theaterkritik, experimentelle Dichtung, Essay, Übersetzung oder Autobiografie, es gibt kein Genre, das er nicht bespielt hätte. Die früheste Publikation datiert aus seiner Studienzeit, eine Kunstrezension im Bonner Volksmund von 1912, die letzte erschien 1975, ein Jahr vor seinem Tod, in Paris. Damit präsentieren die Schrift...
"schön scheint die lampe im mond" - ein Satz des bildenden Künstlers Max Ernst, der zeitlebens geschrieben hat und dessen literarisches Werk jetzt erstmals umfassend in deutscher Sprache zugänglich ist. Ob Gedicht, Kurzprosa, Roman oder Theaterstück, Kunst- und Theaterkritik, experimentelle Dichtung, Essay, Übersetzung oder Autobiografie, es gibt kein Genre, das er nicht bespielt hätte. Die früheste Publikation datiert aus seiner Studienzeit, eine Kunstrezension im Bonner Volksmund von 1912, die letzte erschien 1975, ein Jahr vor seinem Tod, in Paris. Damit präsentieren die Schriften einen Schaffensprozess von über sechzig Jahren, in denen sich Max Ernst virtuos zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch bewegt.