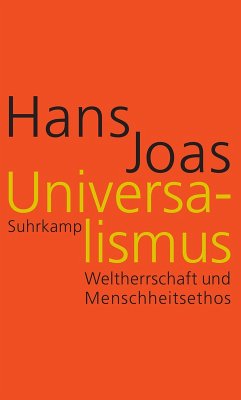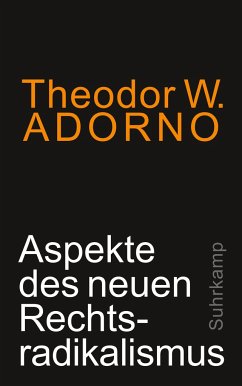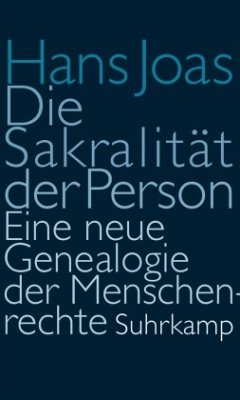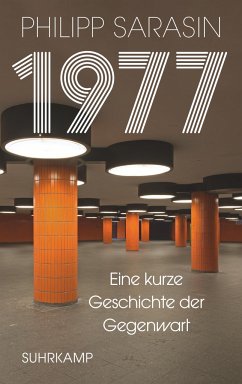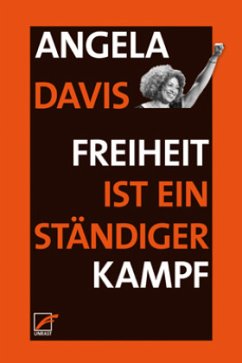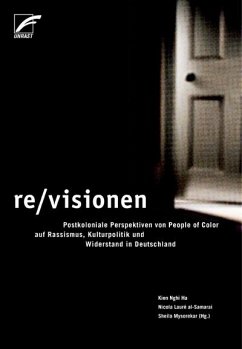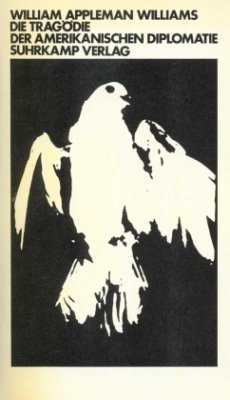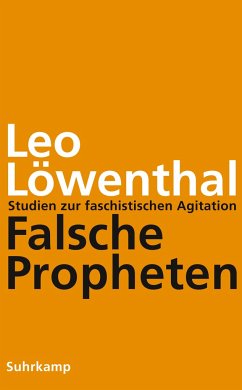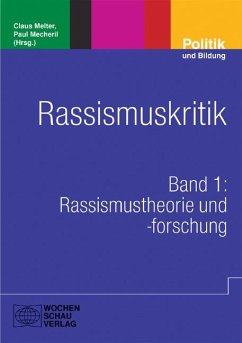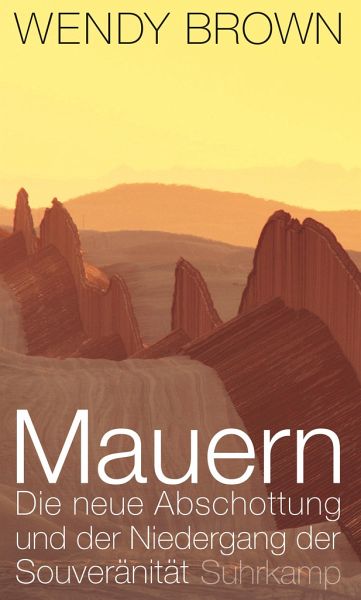
Mauern
Die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität
Übersetzung: Lachmann, Frank

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Warum bauen immer mehr Staaten eine Mauer, wo doch zugleich im Zeichen von Globalisierung und digitaler Vernetzung seit Jahren eine Welt ohne Grenzen beschworen wird? Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Wendy Brown geht in ihrem preisgekrönten Buch dieser paradoxen Entwicklung auf den Grund.Ein US-Präsident, der verspricht, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen; rechtspopulistische Parteien, die die »Festung Europa« gegen Flüchtlinge absichern wollen; gewaltige Mauerbauprojekte zwischen Israel und Palästina, Südafrika und Zimbabwe, Indien und Pakistan oder Irak und Saud...
Warum bauen immer mehr Staaten eine Mauer, wo doch zugleich im Zeichen von Globalisierung und digitaler Vernetzung seit Jahren eine Welt ohne Grenzen beschworen wird? Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Wendy Brown geht in ihrem preisgekrönten Buch dieser paradoxen Entwicklung auf den Grund.
Ein US-Präsident, der verspricht, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen; rechtspopulistische Parteien, die die »Festung Europa« gegen Flüchtlinge absichern wollen; gewaltige Mauerbauprojekte zwischen Israel und Palästina, Südafrika und Zimbabwe, Indien und Pakistan oder Irak und Saudi-Arabien: Eine neue Abschottung hat weltweit Konjunktur, obwohl das Ausmaß globaler Vernetzung es illusorisch erscheinen lässt, durch den simplen Bau einer Mauer die Probleme der Gegenwart lösen zu können. Diese neuen Mauern gleichen für Brown daher eher theatralischen Inszenierungen und sind Ausdruck eines Bedürfnisses nach Übersichtlichkeit und einfachen Lösungen in einer immer komplexer werdenden Welt. Sie markieren einen schmerzhaften Niedergang nationaler Souveränität.
Ein US-Präsident, der verspricht, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen; rechtspopulistische Parteien, die die »Festung Europa« gegen Flüchtlinge absichern wollen; gewaltige Mauerbauprojekte zwischen Israel und Palästina, Südafrika und Zimbabwe, Indien und Pakistan oder Irak und Saudi-Arabien: Eine neue Abschottung hat weltweit Konjunktur, obwohl das Ausmaß globaler Vernetzung es illusorisch erscheinen lässt, durch den simplen Bau einer Mauer die Probleme der Gegenwart lösen zu können. Diese neuen Mauern gleichen für Brown daher eher theatralischen Inszenierungen und sind Ausdruck eines Bedürfnisses nach Übersichtlichkeit und einfachen Lösungen in einer immer komplexer werdenden Welt. Sie markieren einen schmerzhaften Niedergang nationaler Souveränität.