Leben auf dem Himmelskörper Anlaß gaben. Insbesondere der amerikanische Astronom Percival Lowell heizte die Öffentlichkeit mit seiner These an, die Bewohner auf dem Mars seien uns Menschen weit voraus. Denn das System der Kanäle zur Bewässerung des Planeten beweise, daß sie ihre Staaten abgeschafft und nur noch eine einzige Regierung für den gesamten Planeten hätten. In ihrer Ausgabe vom 27. August 1911 ging die renommierte New York Times auf die neuesten Erkenntnisse Lowells ein und berichtete, die Marsianer hätten den Kanälen allein in den vergangenen zwei Jahren zwei gewaltige Exemplare hinzugefügt - eine enorme technische Leistung.
In dem Buch "Marsfieber" haben Rainer Eisfeld und Wolfgang Jeschke lesenswerte Details über die Erforschung des roten Planeten und dessen Bewältigung in der Literatur zusammengetragen, wobei nicht selten der Gedanke einer fremden, belebten Welt im Mittelpunkt steht. Schon im siebzehnten Jahrhundert wurde über dieses Thema nicht nur unter einzelnen Gelehrten, sondern auch unter interessierten Laien in den Salons diskutiert. Damals, 1686, veröffentlichte Fontanelle seine brillanten "Gespräche über die Vielzahl der Welten".
Mit dem Basiswissen, das die Astronomen zur Verfügung stellten, entstand eine Gattung der Literatur, die irdische Themen in den Weltraum verlegte. In einer Zeit, als die Europäer neue Kolonien errangen, war in den Romanen - aufbauend auf der weit fortgeschrittenen Marszivilisation - von vergleichbaren Invasionen der Marsianer auf der Erde die Rede. In Kurd Lasswitz' "Auf zwei Planeten" (1897) begreift der Zentralrat des Mars schließlich, daß ein Zerstörungskrieg zur endgültigen Korrumpierung der eigenen Werte führen würde, und die Marsianer ziehen sich wieder von der Erde zurück. In H. G. Wells' zur gleichen Zeit erschienenem "Krieg der Welten" wird die Erde marsianisches Protektorat.
Neueren astronomischen Erkenntnissen folgt Robert Heinlein, der in dem Roman "Der Rote Planet" (1949) einen Himmelskörper beschreibt, auf dessen Oberfläche sich ohne Atmungsapparat "allenfalls Tibeter" wagten. Irdische Auswanderer mußten auf dem bolivianischen Hochplateau ein jahrelanges Trainingslager absolvieren, um sich halbwegs an Kälte und Atemnot zu gewöhnen. Andere Autoren stellen den Mars zur Zeit der ersten Atombomben als Zufluchtsort für den Menschen dar, so Ray Bredbury in den "Mars-Chroniken" (1950), in denen allerdings weiterhin Marsianer auftauchen. Die goldäugigen Wesen werden jedoch von den Windpocken ausgerottet, die irdische Expeditionen einschleppen - eine Reminiszenz an die Dezimierung der Indianer in kolonialer Zeit.
Das reich bebilderte Buch "Marsfieber" spannt einen Bogen von den frühen Tagen der kopernikanischen Wende über die neuzeitliche Marsforschung und Fliegende Untertassen bis hin zu den Plänen, den roten Planeten durch sogenanntes Terraforming für Menschen bewohnbar zu machen. Es ist die spannende Geschichte vom Bild eines Planeten, auf dem längst Astronauten gelandet wären, hätten sich die Träume Wernher von Brauns erfüllt. Die Visionen von Präsident Bush, der den Mars jetzt auch als Ziel bemannter Raumflüge sieht, sind in dem Buch noch nicht berücksichtigt.
GÜNTER PAUL
Rainer Eisfeld und Wolfgang Jeschke: "Marsfieber". Droemer Verlag, München 2003. 272 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
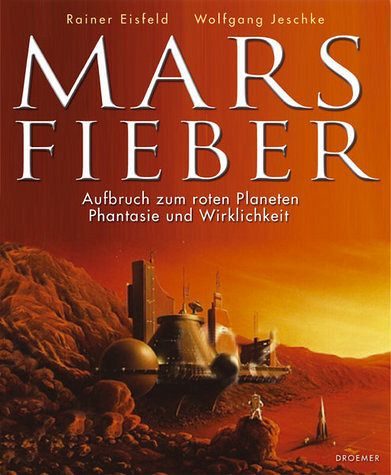













 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.05.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.05.2004