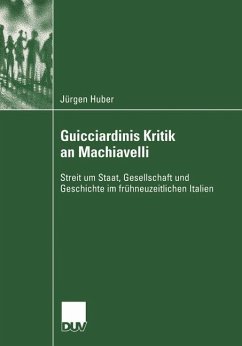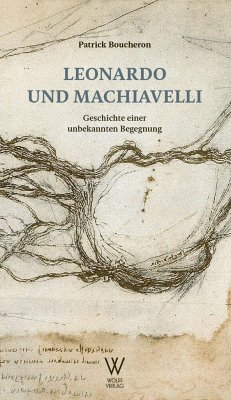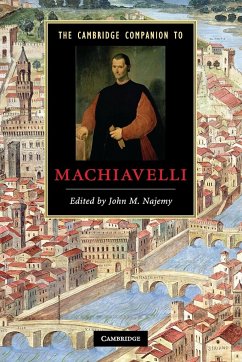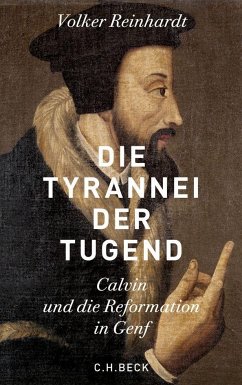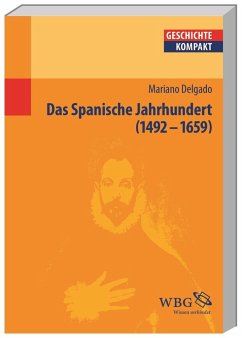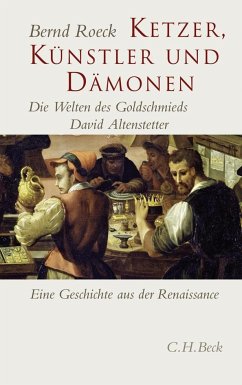Erkenntnisse waren zum Gebrauch gedacht. Nach dem Sturz des Dominikaners Girolamo Savonarola, der mittels das Ende der Welt beschwörender Predigten und fanatisierter Anhänger die Republik Florenz beherrscht hatte, erhielt Machiavelli seine Chance. 1498 wählte ihn der Rat der Achtzig zum Sekretär der Florentiner Regierung und Chef der Zweiten Kanzlei. Der Zweite Kanzler war im Gefüge der Regierung für Fragen der Innen- und Außenpolitik zuständig: von der Organisation des Militärwesens bis zur Diplomatie. Als Sekretär der Stadtregierung leitete er Vorverhandlungen mit auswärtigen Mächten und führte Erkundungsmissionen durch. Diese Aufgaben oblagen nun Machiavelli.
Diplomatische Missionen führten den Geschäftsträger der Republik - den Rang eines Gesandten erhielt Machiavelli nur einmal bei einer unbedeutenden Mission - zu den wichtigsten politischen Entscheidungsträgern seiner Zeit: Er verhandelte mit den Fürsten Italiens, der Kurie, war am Hofe des französischen Königs und des römischen Kaisers und beobachtete den Aufstieg Cesare Borgias zum Herrn der Romagna und dessen tiefen Sturz nach dem Tod von Papst Alexander VI., seinem Vater.
Schon sein Wirken als Diplomat im Zeitalter des Niedergangs der florentinischen Republik, seine literarische Leistung als Autor von Gedichten und Komödien und als stilsicherer Briefeschreiber rechtfertigt eine Biographie. Umso mehr sein Fortwirken als politischer Denker, zu dem sich - mit Bewunderung für den Republikaner und Analytiker oder mit Verachtung für einen Umwerter aller Werte - fast jeder nachfolgende politische Denker äußerte. Volker Reinhardt, ein ausgewiesener Kenner der Renaissance, der seit 1992 an der Universität Fribourg Geschichte lehrt, hat nun eine umfassende Biographie Machiavellis vorgelegt: seit langem die erste wissenschaftlichen Anforderungen genügende Darstellung und ein rundum gelungenes Buch.
Als sich Florenz 1511 auf die Seite des Gegenpapstes Ludwig XII. stellte, verhängte Julius II. schwere Kirchenstrafen gegen die Stadt. Da diese sich uneinsichtig zeigte, ging der Papst militärisch gegen die Republik vor. Im August 1512 erzwang ein spanisch-päpstliches Heer die Kapitulation der Republik und die Rückkehr der Medici. Auch Machiavelli, entschiedener Parteigänger der republikanischen Ordnung, verlor noch im November sein Amt, im Februar des folgenden Jahres wurde er verhaftet, gefoltert, aber schließlich anlässlich der Wahl des Kardinals Giovanni de' Medici zum Papst (Leo X.) amnestiert. Jeglichen politischen Einfluss hatte er verloren, und nur das Exil gewährte ihm Sicherheit.
In seinem Gut bei San Casciano, nahe Florenz, verfasste Machiavelli nun seine berühmten staatstheoretischen Schriften, "Der Fürst" und die "Discorsi", außerdem drei Komödien und eine Vielzahl von Gedichten, politische und militärische Abhandlungen - darunter die "Kunst des Krieges" und eine "Geschichte der Stadt Florenz". Die Schriften sind Resümee seiner politischen Tätigkeit und der immer wieder aufgenommenen Lektüre der römischen Geschichtsschreibung, teilweise aber auch der Versuch, sich wieder einen Weg in den Dienst des Staates zu verschaffen. Obwohl er mit kleinen Missionen betraut wurde und einige Schriften Auftragsarbeiten waren, blieb ihm die Rückkehr jedoch versagt.
Das politische Denken Machiavellis, wie wir es aus diesen Schriften kennen, war über Jahrhunderte ein Skandal - noch 1958 nannte ihn der Philosoph Leo Strauss einen "Lehrer des Bösen". Nicht wegen seiner rücksichtslosen Ratschläge oder seines Verständnisses von Politik, sondern weil er diese den Menschen - die unfähig sind, solche Wahrheit zu ertragen - in ungeschminkter Direktheit sagte. Niemand hat bis dahin mehr als Machiavelli die moralische Verworfenheit des Menschen, aber auch seine Unfähigkeit zum rationalen Handeln präziser und genauer beschrieben. Machiavelli sah genau hin. Er analysierte die Triebkräfte der Politik: die Zufälligkeit der Umstände, die er Fortuna nannte, die Unfähigkeit der Menge, überlegt zu handeln - aber auch die Fähigkeit, angesichts dessen zu herrschen, ohne Rücksicht auf Glaubensvorschriften oder Ethik. Angesichts der Maßlosigkeit des Menschen wollte Machiavelli wenigstens Stabilität der Herrschaft eines Fürsten, besser noch das Institutionsgefüge einer Republik.
Vor allem die Methode der Darstellung in Reinhardts Biographie ist klug gewählt: Aus der Lektüre, dem Studium der großen römischen Historiker, aus seiner Beobachtung der Politik, Verhandlungen und Interessen - niedergeschrieben in ausführlichen Gesandtschaftsberichten und zahllosen umfangreichen Briefen - gewinnt Machiavelli seine Ansichten über die Funktionsweise der Politik. Sie nehmen in Reinhardts Buch zu Recht einen großen Raum ein. Und aus diesen Tätigkeiten und Schriften leitet Reinhardt die Idee von Machiavellis wichtigsten Werken ab. Solchermaßen wird das Denken Machiavellis, die Erarbeitung der Theorie aus der Praxis, deutlich. Auch die tiefe Verbitterung und Enttäuschung des Florentiners, die seine Schriften kolorierten. Dieser sarkastische, oft bittere Ton (vor allem in den späten Briefen) erklärt sich durch die Erfahrungen am eigenen Leibe.
Das Scheitern ist ein Leitmotiv seines Lebens. 1526 betraut Florenz Machiavelli zum letzten Mal mit einer diplomatischen Mission. Seit 1523 herrschte dort mit Clemens VII. erneut ein weiterer Medici als Papst. Machiavelli beobachtete und kommentierte das Vorrücken des spanisch-päpstlichen Heeres auf den Kirchenstaat. Deutsche und spanische Söldner eroberten und plünderten die Heilige Stadt, der berühmte Sacco di Roma. Als die Medici nach der Niederlage des Papstes Florenz verlassen müssen, kommt es noch einmal zu einer Volksherrschaft. Sie aber bedarf des Denkers und Diplomaten Machiavelli nicht. Die Nachricht, dass er kein Amt erhalten werde, erreicht ihn elf Tage vor seinem Tod.
Reinhardt arbeitet überzeugend heraus, wie Machiavellis pessimistische Erkenntnisse über die Natur des Menschen und das Wesen der Politik diesem auch sein eigenes Scheitern erklärten. Es ist der mangelhaften menschlichen Erkenntnisfähigkeit gemäß, dass Florenz auf seinen besten Denker verzichtet. Eine bittere Wahrheit für den "Historiker, Komiker und Tragiker", als den er sich selbst sah. Eine "ideale" oder wenigstens eine am Guten ausgerichtete Ordnung sah Machiavelli, angesichts des Tobens von Fortuna, des ewigen Kreislaufes von Aufstieg und Verfall, als nicht erreichbar an. Aber eine besser regierte Republik wäre im Interesse aller ihrer Bürger. Er war überzeugt, den Weg dahin zu kennen.
DIETMAR HERZ
Volker Reinhardt: "Machiavelli oder die Kunst der Macht". Eine Biographie. Verlag C. H. Beck, München 2012. 400 S., Abb., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
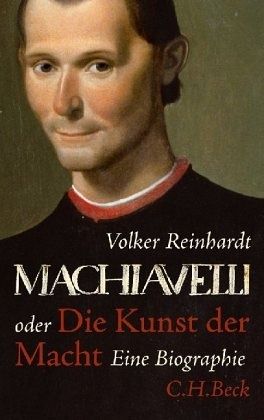



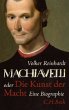


 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.03.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.03.2012